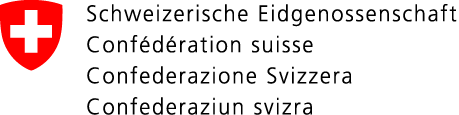Mit Beginn der Industrialisierung rückte die Verwundbarkeit der Natur ins Bewusstsein der Menschen. Zuvor galt Mutter Erde als mitunter launische und zerstörerische, auf jeden Fall aber übermächtige Spenderin von Nahrung und anderen lebenswichtigen Gütern. Der Wandel der Betrachtungsweise widerspiegelt sich in der Rechtsetzung.
Text: Lucienne Rey
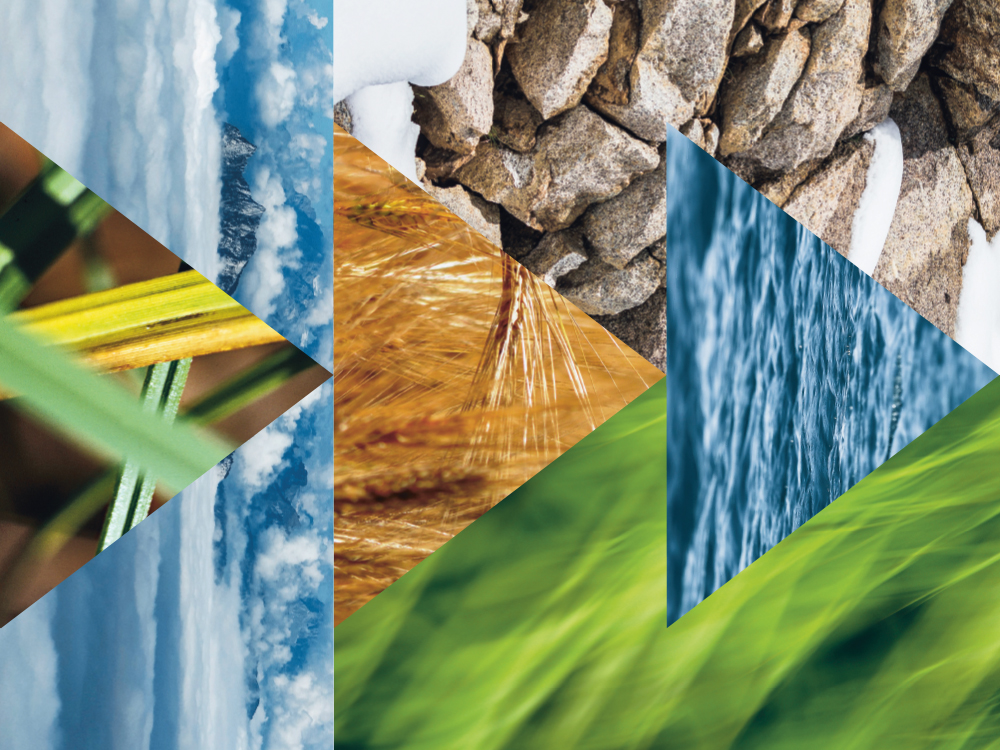
Im alten Testament setzt Gott durchaus einmal eine Sintflut, einen Hagelsturm oder andere natürliche Phänomene ein, um Fehlverhalten seiner Geschöpfe zu ahnden. Die Natur dient hier somit als Instrument für die Strafe eines göttlichen Gerichts. Höchst selten aber tritt sie in der Überlieferung selbst als Rechtssubjekt in Erscheinung. Einen solchen Einzelfall beschreibt der griechische Geschichtsschreiber Herodot (ca. 490–420 v. Chr.): Nachdem die stürmische See die Brücke vernichtet hatte, über welche die Perser auf ihrem Kriegszug gegen Griechenland (ca. 480 v. Chr.) die Meeresenge der Dardanellen – in der Antike «Hellespont» genannt – überqueren wollten, befahl Perserkönig Xerxes, «dem Hellespont dreihundert Schläge mit einer Peitsche zu geben und ein paar Fusseisen in das Meer zu versenken». Der Herrscher züchtigte damit das aufrührerische Wasser.Uns mag die Bestrafung des Meeres befremden. Doch in anderen Kulturen können wichtige Naturobjekte durchaus zur juristischen Person erklärt werden – allerdings nicht, um sie abzustrafen, sondern um sie zu schützen. «In Neuseeland etwa wurde bedeutenden Flüssen, die den Indigenen heilig sind, eine Rechtspersönlichkeit zugewiesen», erklärt Florian Wild, Abteilungschef Recht beim BAFU. Da ein Fluss nicht für sich selbst sprechen könne, brächten Einheimische die Anliegen der Naturwerte in die juristischen Verfahren ein, führt der Rechtsexperte aus. Ein Ansatz, der auch in der Schweiz diskutiert wird: So forderte eine Nationalrätin in einem Postulat, es sei die Möglichkeit zu prüfen, die Gletscher mit einer Rechtspersönlichkeit auszustatten.
Natur vor Gericht
In Europa hingegen kam die Natur lange Zeit, wenn überhaupt, als Übeltäterin vors Tribunal. Aus dem Mittelalter sind Berichte über Gerichtsverfahren überliefert, die gegen Nutztiere, aber auch gegen Nager und Insekten geführt wurden. In seiner Berner Chronik erwähnt Valerius Anshelm (1475–1547) für das Jahr 1479 einen «wunderlichen, abergloubigen Rechtshandel», bei dem es darum ging, «die schadhaften, reubischen inger [= Engerlinge], käfer und wirm» vor ein ordentliches Gericht in Lausanne zu bringen. Dort wurden sie schuldig gesprochen – womöglich wegen ihres unfähigen Fürsprechers, wie der Chronist einräumt – und mit einem Bann belegt. Neueren rechtshistorischen Untersuchungen zufolge ist allerdings bei vielen solcher Schriften unklar, ob sie sich auf tatsächlich stattgefundene Prozesse beziehen oder ob es sich um satirische Erzählungen handelt.
Vom Menschen aus gedacht
Bei allen Unterschieden ist den oben erwähnten Fällen eines gemeinsam: Die Natur – sei es ein Sturm, sei es ein Käferschwarm – wird vom Standpunkt der zwischenmenschlichen Moral in den Blick genommen und be- bzw. verurteilt. Daran änderte auch die Aufklärung nichts. In seiner «Metaphysik der Sitten» verwahrt sich Immanuel Kant (1724–1804) zwar gegen die gewaltsame und grausame Behandlung von Tieren; aber nicht um ihrer selbst willen, sondern «weil dadurch das Mitgefühl an ihrem Leiden im Menschen abgestumpft und dadurch eine der Moralität im Verhältnisse zu anderen Menschen sehr diensame natürliche Anlage geschwächt und nach und nach ausgetilgt wird». Anders gesagt: Wer Tieren gegenüber ohne Mitleid handelt, wird früher oder später auch gegen seine Mitmenschen grausam sein.
Der Erlass der ersten Schweizer Gesetze, die auf die Regulierung von Jagd und Fischerei oder auf die Nutzung des Waldes und der Gewässer abzielten, war jedenfalls stark von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen motiviert. So hob der Bundesrat in seiner Botschaft vom 26. Mai 1875 «betreffend Entwurf eines Bundesgesezes über die Jagd und den Schuz der nüzlichen Vögel» die «volkswirtschaftliche Bedeutung des Tierschutzes und den rationellen Betrieb von Jagd und Fischerei» hervor. Tatsächlich sei die frühe Gesetzgebung zum Schutz der Natur anthropozentrisch gewesen, bestätigt Florian Wild, habe also ganz den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Er weist ausserdem auf ihre thematische und räumliche Begrenzung hin: «Das erste Forstpolizeigesetz von 1876 bezog sich einzig auf den Wald im Hochgebirge. Mit dem zweiten von 1902 dehnte der Bund seine Regulierung auf die ganze Schweiz aus, ohne dabei den Wald im Rechtsinne zu definieren und mit Priorisierung der Förderung des Schutzwaldes. Das Waldgesetz von 1991 schliesslich regelt als Rahmengesetz die Walderhaltung, gesamtheitlich koordiniert mit der übrigen Umweltgesetzgebung. Die Regulierung der Walderhaltung wurde damit aufgrund der Herausforderungen beim Umweltzustand und des steigenden Problembewusstseins schrittweise ausgedehnt.»
Ähnlich verhielt es sich bei den Bundesgesetzen und deren Vorläufern des Arten-, des Gewässer- sowie des Natur- und Heimatschutzes. «Entscheidend für eine wirksame Umweltgesetzgebung ist, dass auf nationaler wie internationaler Ebene die notwendigen ergänzenden Schutznormen und -instrumente gegen die Klimaerwärmung, zur Erhaltung der Biodiversität und zur Schonung der natürlichen Ressourcen erlassen werden können», führt der BAFU-Rechtsexperte im Hinblick auf die Zukunft aus.
Das Schöne schützen
Es waren Kunstschaffende und geschichtlich interessierte Personen, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts für einen umfassenderen Landschafts- und Naturschutz stark machten. Entsprechend hiess der 1905 gegründete Verein, der wenig später zur Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz werden sollte, zunächst Ligue pour la beauté. Für Anders Gautschi, Geschäftsführer des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS), ist es nachvollziehbar, dass es nicht die Wissenschaft war, die sich als Erstes für den Natur- und Umweltschutz einsetzte. «Wenn Bäume gefällt oder neue Siedlungen errichtet wurden, war das direkt sichtbar, und die Menschen haben sich daran gestossen. Umweltschäden durch Chemikalien oder Überdüngung sind hingegen nicht immer offensichtlich oder haben einen indirekten Zusammenhang und blieben auch für die Wissenschaft lange Zeit verborgen.»
Erst ein halbes Jahrhundert später wurde 1962 der neue Artikel 24sexies in die alte Bundesverfassung eingefügt, der den Bund unter anderem ermächtigte, «Bestimmungen zum Schutze der Tier- und Pflanzenwelt zu erlassen». Er diente als Grundlage für das vier Jahre später erlassene Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG). Dieses verpflichtet den Bund, die einheimische Tier- und Pflanzenwelt und ihren Lebensraum zu schützen und die Bestrebungen von Vereinigungen zum Schutz von Natur und Lebensraum zu unterstützen. Natur- und Heimatschutzverbänden, die national tätig und ideellen – also nicht wirtschaftlichen – Werten verpflichtet sind, wurde damit das Beschwerderecht zugesprochen.
Fürsprecher der Natur
Anders Gautschi vom VCS zieht eine positive Bilanz aus dem Beschwerderecht: «In der Vergangenheit konnten viele für die Umwelt problematische Eingriffe verhindert werden.» Mit der Folge, dass heute Projekte von vornherein sorgfältiger geplant und die massgeblichen Organisationen von Umwelt- und Heimatschutz frühzeitig beigezogen werden. Zunehmend setzt sich eine umfassende Sicht auf Eingriffe in Natur und Landschaft durch: «Wird in einem unberührten Gebiet eine Anlage erstellt, ist nicht zwingend der direkte bauliche Eingriff problematisch. Aber die Folgen wie Verkehr und Lärm fallen möglicherweise umso mehr ins Gewicht», so der Fachmann, der auf die zunehmende Beanspruchung natürlicher Freiräume hinweist.
Verglichen mit früheren Jahren sei heute die Sicht auf bauliche Vorhaben gesamtheitlicher geworden, führt Anders Gautschi weiter aus. Entsprechend zahlt sich die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Verbände aus: «Die einen sind spezialisiert auf die Auswirkungen auf die Natur, die anderen auf die historische Baukultur, wieder andere auf den Verkehr. Entsprechend übergreifend wird auch die Argumentation.» Dass viele Beschwerden berechtigt und keineswegs politische Zwängerei sind, zeigt sich daran, dass zahlreiche Fälle im Sinn der Beschwerdeführung entschieden werden. «Diese Präzedenzfälle unterstreichen die Legitimation unserer Anliegen und erleichtern zunehmend einvernehmliche Lösungen», freut sich Anders Gautschi.
Achtung vor Nichtmenschlichem
Das immer tiefer greifende Verständnis der Wissenschaft von allem Lebendene führte schliesslich vor knapp 20 Jahren dazu, dass die Argumente des Naturschutzes um eine weitere, philosophische Dimension angereichert wurden: «Das Bundesgesetz über die Gentechnik im Ausserhumanbereich fordert ausdrücklich, die Würde der Kreatur bei Tieren und Pflanzen sei zu achten», führt Florian Wild vom BAFU aus. Auch im Landschaftsschutz untermauern die Gerichte ihr Urteil gelegentlich mit naturethischen Argumenten, so etwa in der Auseinandersetzung um die nächtliche Beleuchtung des Pilatus bei Luzern.
Läge es da nicht nahe, wichtigen Naturgrössen – beispielsweise den Gletschern – eine Rechtspersönlichkeit zuzuweisen? In seiner Stellungnahme vom 14. Februar 2018 gab der Bundesrat zu bedenken, «es würde unserem Rechtsverständnis zuwiderlaufen», Gletschern oder vergleichbaren «Sachen» eine Rechtspersönlichkeit zu verleihen. Zudem sind Gletscher durch landschaftsschutzrechtliche Schonvorschriften und teilweise mittels Schutzzonen geschützt. Wo dieser Schutz nicht eingehalten wird, bestehen mit dem Verbandsbeschwerderecht und dem Behördenbeschwerderecht des BAFU Instrumente, um Schäden der Natur abzuwenden.
Recht - Moral - Ethik
Seit im Umweltschutz nicht mehr in erster Linie naturwissenschaftliche, sondern auch philosophische Argumente ins Feld geführt werden, unterhält das BAFU ein Comité d'éthique. Doch wie stehen Recht, Moral und Ethik zueinander? «Rechte zielen als Verhaltensnormen auf das menschliche Handeln ab, und sie sind mit staatlichen Mitteln durchsetzbar», erläutert Florian Wild. Die Moral hingegen widerspiegle gesellschaftliche Erwartungen an das Verhalten, die indes staatlich nicht durchgesetzt werden könnten. Wenn eine Gesellschaft eine Verhaltensweise sehr einheitlich beurteile, so könne sich diese auch ohne rechtliches Fundament durchsetzen, so der Rechtsexperte. Heute aber liege eine Schwierigkeit darin, dass die Moralvorstellungen in der Gesellschaft vielfältig geworden seien; nicht zuletzt deshalb seien immer mehr Rechtsetzungen erforderlich. Die Ethik als Wissenschaft schliesslich untersuchte unter anderem die Begründung moralischer Regeln und definierte Kriterien für gutes und schlechtes Handeln. Die nächste Ausgabe von «die umwelt» widmet sich in ihrem Schwerpunkt der Ethik und der Moral.
Weiterführende Informationen
Letzte Änderung 01.09.2021