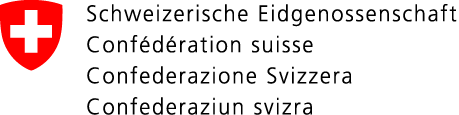Für die deutsche Umweltethikerin Uta Eser ist die Biodiversität viel mehr als ökonomische Grundlage unseres Lebens. Sie sagt, in der Natur könne der Mensch sich selbst begegnen und Haltungen entwickeln. Ein Gespräch über Alarmismus in Umweltschutz-Kampagnen und zur Frage, ob wir die Schnecke im Salat töten dürfen.
Interview: Peter Bader

© Miriam Künzli | Ex-Press | BAFU
Frau Eser, welches ist Ihr Lieblingsort in der Natur?
Uta Eser: Ich habe das grosse Glück, dass es gleich neben unserem Quartier einen weiträumigen naturnahen Wald gibt. Ich versuche, dort jeden Tag eine Stunde spazieren zu gehen. Die Bewegung, die Ruhe und das Grün tun mir gut. Ich geniesse den Wechsel der Jahreszeiten, das Kommen und Gehen, das Eingebundensein in ein grösseres Ganzes.
Welche Note von 1 bis 10 geben Sie sich selbst im behutsamen Umgang mit der Natur?
Eine 3 bis 4.
Oha, ungenügend?
Ja, obwohl ich mich sehr bemühe, kann ich mich der modernen Welt doch nicht ganz entziehen. All die Hightechgeräte, die uns die Kommunikation erleichtern oder Mobilität ermöglichen, haben einen ökologischen Rucksack, der viel grösser ist, als es die natürlichen Ressourcen unserer Erde verkraften. So ist auch mein Fussabdruck immer noch viel zu gross.
Lassen Sie sich von Umweltschutz-Kampagnen beeinflussen?
Nein, eher nicht. Aber neue Informationen sind für mich natürlich schon relevant.
Die Kampagnen zum Schutz der natürlichen Ressourcen stellen sehr oft ökonomische Werte in den Vordergrund. Zu Recht?
Es ist in jedem Fall ein sehr wichtiges Argument, das vor allem diejenigen am ehesten erreicht, die keine emotionale Bindung zur Natur haben. Denn sie merken: Wir sind ganz existenziell auf natürliche Ressourcen angewiesen – beim Essen, beim Trinken, bei der Behausung, bei Brennmaterialien oder Medikamenten. Damit wird deutlich: Wenn wir mit den natürlichen Ressourcen weiterhin so sorglos umgehen wie bisher, kann es sehr unangenehm werden. Und es kann nicht schaden, wenn das Ganze auch mit einer gewissen Leichtigkeit daherkommt. Wie bei einer Kampagne, die von Studierenden im deutschen Freistaat Sachsen konzipiert wurde. Der Slogan lautete: «Ohne Frosch, kein Bier.» Das gefällt mir gut, auch wenn ich die direkte kausale Beziehung zwischen Fröschen und Bier grad nicht aufzeigen kann (lacht). Aber die Kampagne lenkt den Blick auf einen grundsätzlichen Widerspruch: Insekten zum Beispiel können uns in manchen Situationen sehr lästig sein, mit der Bestäubung der Pflanzen hingegen sind sie für uns existenziell wichtig.
Würden alle Menschen so leben wie wir in der Schweiz, dann bräuchten wir drei Erden, um eine Übernutzung zu verhindern. Ist angesichts solcher Tatsachen nicht eine gewisse Dringlichkeit angezeigt?
Ich bin skeptisch, ob Alarmismus wirklich hilft. Wenn wir uns ständig von Weltuntergangsszenarien umstellt sehen, wollen wir davon ab einem gewissen Punkt gar nichts mehr wissen. Denn man sagt sich: Was kann ich als Einzelne oder Einzelner schon angesichts dieses riesengrossen Problems überhaupt ausrichten?
Als Umweltethikerin verfolgen Sie ohnehin einen anderen Ansatz. Sie sagen: Die Natur macht uns glücklich!
Ja, aber nicht in erster Linie in einem oberflächlichen Sinn, als dass wir in der Natur glücklich sind und sie uns guttut. Vielmehr begegnen wir uns in der Natur immer auch ein bisschen selbst. Wir sind ja auch Natur. Wie wir uns zur Natur um uns in Beziehung setzen, hat deshalb auch etwas mit der Natur in uns zu tun.
Was heisst das konkret?
Dass wir uns im Umgang mit der Natur selbst kultivieren. Dabei lernen wir nicht nur, Rücksicht auf die Natur zu nehmen, sondern auch auf andere Menschen oder auf fremde Seiten in uns selbst. Wir Menschen haben ja auch innere Widersprüche und Eigenschaften, die uns ein bisschen fremd sein können. In der Natur lernen wir uns besser kennen und entwickeln dabei Haltungen und Respekt.
Sind das Erfahrungen, die jeder macht?
Nein, nicht unbedingt. Aber jeder hat das Recht darauf, sie machen zu können.
Hat die Natur aus Sicht der Umweltethik einen Wert an sich? Machen wir uns schuldig, wenn wir eine Pflanze zertreten?
Mir persönlich geht das viel zu weit. Aber es ist ohnehin eine strittige Frage. Wenn ich einen Hund, den mir eine Freundin für drei Wochen anvertraut hat, nicht füttere und ihm nichts zu trinken gebe, sind wir uns alle einig, dass ich ihm unrecht tue. Er hat als fühlendes Lebewesen einen Wert an sich. Wenn ich allerdings eine Stechmücke erschlage, die sich gerade auf mir niederlässt, die Zecke ziehe, die sich mein Sohn im Wald eingefangen hat oder die Schnecke im Salat entsorge, habe ich nicht das Gefühl, grosses Unrecht auf mich zu laden.
Zu Recht?
Als Teil des Haushalts der ganzen Natur können wir ja fast nicht anders. Dazu gehört, dass wir bei jedem Lebensvollzug Gefahr laufen, andere Lebewesen zu beinträchtigen. Beim Salat stellt sich letztlich die Frage: Die Schnecke oder ich? Zugegeben: Da drückt auch ein bisschen meine landwirtschaftliche Herkunft durch, ich bin auf einem Weingut aufgewachsen. Natürlich habe ich Hochachtung vor Menschen, die es möglichst vermeiden wollen, andere Lebewesen zu schädigen. Manche buddhistischen Mönche tun das beispielsweise. Mir persönlich geht das aber zu weit, ich halte das nicht für eine moralische Forderung, die sich an alle stellen lässt. Hinzu kommt, dass man in vielen Gegenden gar keinen Ackerbau betreiben kann und deshalb zum Überleben auf tierische Produkte angewiesen ist. Es können nicht alle vegan leben.
Würden Sie dafür plädieren, dass ethische Argumente in Naturschutz-Kampagnen vermehrt
berücksichtigt werden?
Ich glaube, dass sehr viele Menschen schon dafür sensibilisiert sind, dass uns die Natur glücklich macht und uns guttut. Im Rahmen der Erarbeitung der Schweizer Biodiversitätsstrategie und des entsprechenden Aktionsplans wurde in der Vernehmlassung deutlich, dass es den Leuten längst nicht nur um den ökonomischen Wert der biologischen Vielfalt geht, sondern vor allem auch um den ideellen und ethischen. Das haben auch deutsche Naturbewusstseinsstudien bestätigt. Das Problem ist vielmehr, dass viele umweltbewusste Menschen das Gefühl haben, sie seien in einer Minderheit – und es gebe deutlich mehr Menschen, denen die Natur egal ist und die sie deshalb auch kaputt machen. Eine solche Haltung verhindert die Wahrnehmung von Verantwortung. Aber nur auf das eigene Handeln haben wir direkten Einfluss und nur für das eigene Handeln tragen wir Verantwortung.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Dass es uns gelingen müsste, den Menschen klarzumachen, dass es längst nicht nur böse Naturverächter sind, die die Natur zerstören, sondern auch ganz viele Naturliebhaber. Und zwar nicht, weil sie das wollen, sondern weil ihnen andere Dinge auch noch wichtig sind: Mobilität, Ferien usw. Dazu zähle ich mich auch, ich habe mir ja eingangs auch eine ungenügende Note gegeben.
Wie kann eine solche Bewusstseinsänderung gelingen?
Unabhängig von der Unterscheidung zwischen Naturliebhabern und Naturverächtern ist das Grundproblem folgendes: Wir als Menschen sind nun einmal so gestrickt, dass uns das Hemd näher ist als die Jacke. Wenn wir in Europa Produkte mit Palmöl kaufen, für das in weit entfernten Ländern grossflächig Regenwald gerodet wird, betrifft uns das nicht direkt – allenfalls unsere nachkommenden Generationen. Und deshalb brauchen wir politische und ökonomische Rahmenbedingungen, die uns Menschen, die wir meist kurzfristig und egoistisch handeln, dazu bringen, nicht immer Dinge zu tun, die uns langfristig schaden.
Welche zum Beispiel?
Anstatt zu appellieren, dass man keine Palmölprodukte mehr kaufen soll, müssten die Preise die ökologische Wahrheit widerspiegeln. Umweltkosten oder soziale Kosten für Produkte, die in Billiglohnländern produziert werden, würden damit auf die Preise geschlagen. Wir neigen ja dazu, sehr oft das Billigste zu kaufen. Deshalb kann die Politik über den Preis dafür sorgen, dass wir uns für die richtigen Produkte entscheiden.
Kann das gelingen?
Ich bin nicht wirklich optimistisch, weil machtvolle Interessen involviert sind. Trotzdem halte ich es mit dem Prinzip Hoffnung, was nicht zwingend bedeutet, dass es dann auch gut wird. Wenn wir aber nicht mal damit beginnen, wird es in keinem Fall gelingen.
Weiterführende Informationen
Letzte Änderung 06.03.2019