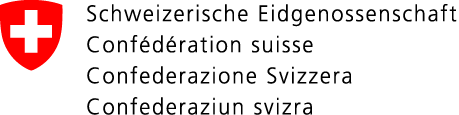Derzeit lassen sich genom-editierte Pflanzen praktisch nicht identifizieren. Das BAFU hat das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt beauftragt, herauszufinden, ob es Chancen für einen praktikablen Nachweis gibt.
Text: Christian Schmidt und Nicolas Gattlen

© Kilian Kessler | Ex-Press | BAFU
Das Flattern der Tauben vor den grossen Fenstern wird immer wieder zum lautesten Geräusch. Es macht sich so stark bemerkbar, weil Claudia Bagutti und Melanie Schirrmann in der Bibliothek des Kantonalen Laboratoriums Basel-Stadt (KLBS) still und konzentriert über Fragen nachdenken, auf die noch niemand eine Antwort gefunden hat.
Claudia Bagutti ist Leiterin des Biosicherheitslabors, Melanie Schirrmann ihre engste Mitarbeiterin. Bis vor Kurzem, das heisst: Bis zur Entwicklung der Genschere mit dem Namen CRISPR/Cas im Jahr 2012, waren die Arbeitsabläufe der beiden erprobt und geregelt. Dazu gehörte unter anderem, an Häfen oder Bahnhöfen gefundene Luzerne- oder Rapspflanzen auf klassische gentechnische Veränderungen (siehe Grafik, Artikel «Grosse Diskussionen um einen kleinen Schnitt») zu überprüfen. Die Pflanzen waren aus Samen hervorgegangen, die meist als Verunreinigungen von Hartweizen aus Übersee importiert worden und beim Transport ins Freie gelangt waren. Fanden sich Beweise, dass fremdes Erbmaterial in die Pflanzen eingefügt wurde, mussten die Funde vorschriftsgemäss vernichtet werden. Das Spektrum an möglichen gentechnischen Veränderungen war bekannt, was den entsprechenden Institutionen – wie etwa dem KLBS – die Entwicklung zuverlässiger Verfahren für deren Nachweis erlaubte. Auch das Resultat war jeweils klar: Entweder waren die Pflanzen gentechnisch verändert, oder sie waren es nicht.
Die Nadel im Heuhaufen
Doch nun ist eine neue Ära angebrochen. Die Forschung hat neue Wege entwickelt, um in das Erbgut von Lebewesen einzugreifen – Stichwort Genome Editing (siehe Grafik, Artikel «Grosse Diskussionen um einen kleinen Schnitt»). Es sind faszinierende Techniken mit so grossem Potenzial für die Entwicklung neuer Produkte, dass die Forschung von einer möglichen nächsten «Agrarrevolution» spricht. Genau dieses Genome Editing bereitet Claudia Bagutti und Melanie Schirrmann nun Kopfzerbrechen. Der Grund: Das KLBS soll im Auftrag des BAFU herausfinden, ob und wie Nachweismethoden für genom-editierte Pflanzen entwickelt werden könnten. Die Methoden sollen erlauben zu prüfen, ob solche Pflanzen in die Schweiz gelangen. Das BAFU hat sich für das KLBS entschieden, weil dieses Labor seit bald zwanzig Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Analysemethoden für gentechnisch veränderte Organismen hat.
Aber wie kann man gentechnische Veränderungen nachweisen, die gar nicht bekannt sind? Im Unterschied zur EU und zur Schweiz werden in Ländern wie den USA und Kanada viele genom-editierte Pflanzen nicht als «gentechnisch veränderte Organismen» (GVO) eingestuft und unterliegen somit keiner Kennzeichnungs- und Nachweisbarkeitspflicht. Da die nordamerikanischen Konzerne die genetischen Veränderungen nicht publizieren müssen, ist die Suche nach diesen vergleichbar mit der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen: Man weiss, es gibt sie, aber trotzdem ist es äusserst schwierig, diese zu finden.
Natürlich oder künstlich herbeigeführt?
«Anders als bei der klassischen Gentechnologie sind die Eingriffe in die Erbsubstanz beim Genome Editing nicht zu erkennen», erklärt Claudia Bagutti. «Denn die Veränderungen lassen sich nicht von Mutationen unterscheiden, wie sie natürlicherweise in jeder Pflanze vorkommen. Trotz ihrer oft grossen Auswirkung sind die gentechnisch herbeigeführten Veränderungen so klein, dass sie in der Menge der natürlichen Veränderungen untergehen.» Mit den bisher verwendeten Analysemethoden liessen sich die künstlichen Eingriffe nicht nachweisen, sagt die Laborleiterin. Und konkrete Ideen für neue, griffige Methoden gebe es nicht.
Claudia Bagutti und Melanie Schirrmann ringen mit denselben Problemen wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den Referenzlaboratorien der Europäischen Union, mit denen sie eng zusammenarbeiten: Die Fachleute klären ab, wie viele genom-editierte Pflanzen alleine in den USA bereits zugelassen und als «nicht gentechnisch veränderter Organismus» eingestuft sind (derzeit sind es an die 70 – vom Mais mit mehr Stärke über herbizidresistenten Raps bis zu Äpfeln und Pilzen, die an den Schnittstellen nicht mehr braun werden). Sie beobachten den Markt in Nordamerika und bereiten sich darauf vor, was dereinst an genom-editierten Pflanzen in die EU und die Schweiz gelangen könnte – als Verunreinigungen von Agrarimporten. Und sie suchen nach Methoden, wie die genom-editierten Pflanzen identifiziert werden können. Bis dato ohne Erfolg: «Alle stehen an», erklärt Claudia Bagutti.
Es gibt noch Hoffnung
Und so wird das Treffen im Kantonslabor zu einem Gespräch über die Chancen und Risiken der modernen Molekularbiologie, insbesondere über die Frage, warum die Agrarkonzerne aus Übersee nicht bekannt geben müssen, wo und wie sie in die Erbsubstanz eingreifen, wenn sie mit Genome Editing arbeiten (bei den bisher gängigen gentechnischen Veränderungen an Organismen mussten die Saatguthersteller entsprechende Nachweisverfahren entwickeln.) Damit wird es den staatlichen Stellen in der EU und in der Schweiz schwer gemacht, ihre Verantwortung als Kontrollorgan wahrzunehmen.
Aber noch gibt es Hoffnung. Denn findige Köpfe haben noch immer Lösungen für scheinbar Unlösbares gefunden. Davon zeugen die stolz blickenden Ahnherren im Treppenhaus des Kantonalen Laboratoriums: Die einstigen Kantonschemiker Basels mit ihren gebürsteten Bärten hatten betrügerischen Krämern auf die Schliche zu kommen, die Weizenmehl mit billigem Mais- oder Hirsemehl versetzten. Sie hatten Bauern zu überführen, die verbotenerweise entrahmte oder mit Wasser verdünnte Milch verkauften. Und nach der Katastrophe von Tschernobyl sahen sich die Nachfolger mit der Herausforderung konfrontiert, die Bevölkerung vor radioaktiv belasteten Nahrungsmitteln zu schützen. Claudia Bagutti: «Und als die Gentechnologie aufkam, hatten wir ebenfalls keine Ahnung, wie wir die Eingriffe nachweisen sollten. Das war eine extrem grosse Herausforderung. Heute ist auch dieser Nachweis Routine.»
Hilft der Super-Computer?
Also hofft sie auf die künftige technologische Entwicklung. Eine Entwicklung, die nicht zuletzt mit der Rechenleistung der Computer und der engen Zusammenarbeit verschiedener Kontrollorgane zusammenhängt. «Geräte, die Milliarden von Basenpaaren in vergleichsweise kurzer Zeit analysieren können, bieten eine mögliche Chance, um die menschgemachten Mutationen im Genom einer Pflanze doch noch von natürlichen Mutationen zu unterscheiden. Dies würde jedoch eine umfassende Datenbank von genom-editierten und von nicht genom-editierten Pflanzen als Kontrolle voraussetzen, was von einer Institution alleine nicht umsetzbar wäre.»
Trennung des Warenflusses ist trotzdem möglich
Die neuartigen genom-editierten Pflanzen lassen sich bis heute im Labor nicht identifizieren. «Nur mit dem Wissen, wo im Erbgut kleine Veränderungen vorgenommen wurden, kann ein spezifischer Nachweis erbracht werden», sagt Markus Hardegger, Leiter Fachbereich Genetische Ressourcen und Technologien beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). Aber auch ohne zuverlässige und präzise Nachweismethoden könne der Warenfluss getrennt und die Wahlfreiheit gewährleistet werden – falls die Informationen dazu öffentlich verfügbar sind. Hardegger verweist auf ähnliche Konstellationen bei anderen Labels: «Viele Labels oder Labelkriterien wie etwa Bio oder Fairtrade können heute analytisch ebenfalls nicht überprüft werden. Wenn aber die entsprechenden Informationen bezüglich Genome Editing am Anfang einer Kette zur Verfügung stehen, kann jedes Label die Glaubwürdigkeit durch Gewährleistung der Warenflusstrennung aufrechterhalten.»
Weiterführende Informationen
Letzte Änderung 29.05.2019