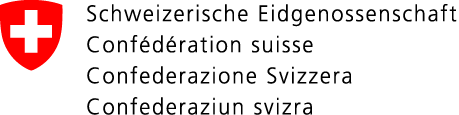Medikamente, Reinigungsmittel oder Dünger sind von rossem Nutzen, können aber für die Umwelt auch problematisch sein. Im Gespräch mit Marc Chardonnens, Direktor des BAFU, und Stephan Mumenthaler, Direktor von scienceindustries, lotet «die umwelt» das Spannungsfeld zwischen Nutzen und Risiken von Chemikalien aus.
Interview: Lucienne Rey

Herr Mumenthaler, Herr Chardonnens, in der Schweiz werden immer wieder Fälle von Altlasten bekannt. So zeigte sich Anfang Juni dieses Jahres, dass im Kanton Wallis in Visp und Raron weit grössere Flächen mit Quecksilber aus der Chemieproduktion belastet sind, als ursprünglich gedacht. Beunruhigt Sie die Vorstellung, dass wir heute möglicherweise nicht alle Gefahren erkennen, die uns in Zukunft Probleme verursachen könnten?
Stephan Mumenthaler: Bei der Strassengesetzgebung ist es auch nicht möglich, jeden Unfall zu verhindern. Vielmehr geht es darum, die grösstmögliche Sicherheit herzustellen und trotzdem noch Verkehr zuzulassen. Regulierungen in anderen Bereichen sind ähnlich. Aber Unfälle lassen sich nie zu 100 Prozent vermeiden.
Marc Chardonnens: In der Umweltpolitik folgen wir dem Grundsatz, im Sinne der Vorsorge an der Quelle der Belastungen anzusetzen, damit keine Probleme für die kommenden Generationen geschaffen werden. Denn heute müssen wir die Folgen von Substanzen bewältigen, die in der Vergangenheit verwendet wurden. Es gibt Stoffe, die vor Jahrzehnten als sehr gut galten, so etwa die polychlorierten Biphenyle (PCB), die sich dank ihrer vorteilhaften technischen Eigenschaften hervorragend als Isolier- und Kühlmedium für Transformatoren und Kondensatoren eigneten. In den 1930er-Jahren war noch nicht bekannt, dass sie sich in der Nahrungskette akkumulieren. Unzählige Stoffe haben exzellente Eigenschaften in einem bestimmten Bereich, aber wir müssen sie mit den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft über gefährliche Eigenschaften und ihr Umweltverhalten neu prüfen. Industrie und Behörden haben die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Risiken so klein wie möglich gehalten werden, auch wenn es bei menschlichen Tätigkeiten immer ein Restrisiko gibt.
Das heisst: Man kann nicht jedes Risiko ausschalten, wenn man den Fortschritt weiterbringen will.

Mumenthaler: Das ist der springende Punkt. Das hervorstechende Merkmal einer Innovation ist eben, dass sie neu ist, und das heisst dann auch: unbekannt. Da gilt es Innovation zuzulassen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich diese Neuheiten bewähren. Denn viele dieser neuen Entwicklungen sind auch für die Umwelt nützlich. Wenn wir deren Belastung ansehen, haben wir nicht zuletzt dank Produkt- und Prozessinnovationen enorme Fortschritte erzielt. Zugleich zeigen sich gewisse Eigenschaften einer Innovation eben erst Jahrzehnte später. Da muss man fortlaufend dazulernen und die gewonnenen Erkenntnisse müssen konsequent in die Weiterentwicklung einbezogen werden.
Chardonnens: Wir haben heute die Risiken besser im Griff, weil wir die Prüfmethoden für chemische Stoffe weiterentwickelt und für bestimmte Chemikalien mit besonderem Risikopotenzial Zulassungsverfahren eingeführt haben. Die hier nötigen Einzelschritte beruhen auf Transparenz, damit wir die Eigenschaften der Substanzen gründlich überprüfen können. Dabei ist es wichtig, dass alle betroffenen Behörden zusammenarbeiten – etwa die Bundesämter für Gesundheitswesen (BAG) und für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), aber auch das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). Wir tauschen unsere Erfahrungen aus, um sicherzustellen, dass die Chemikalienpolitik des Bundes kohärent ist. International pflegen wir die Zusammenarbeit ebenfalls – dies nicht zuletzt, weil es sich bei der Chemikaliensicherheit um eine äusserst dynamische Thematik handelt. Da müssen wir zwischen den Behörden sowohl unser Know-how als auch die Arbeit teilen.
Trotz der Fortschritte bei der Sicherheit im Umgang mit Chemikalien stehen in den Medien oft die Risiken im Vordergrund. Zu Unrecht?
Mumenthaler: Mir scheint, dass den Risiken im Gegensatz zu den Chancen in der öffentlichen Diskussion generell überproportional viel Gewicht eingeräumt wird. Ich komme noch einmal auf meinen Vergleich mit dem Verkehr zurück: In den Medien lesen Sie nur von Autounfällen und kaum je einen Artikel darüber, wie viele Leute mit dem Auto sicher ans Ziel gekommen sind.
Chardonnens: In der Schweiz wurden viele Fortschritte erzielt. So haben wir in den letzten Jahrzehnten zahlreiche schädliche Substanzen vom Markt genommen – etwa, weil sie hormonaktiv sind, Krebs erzeugen oder die Ozonschicht zerstören. Wir müssen aber auch daran denken, dass die Schweiz viele chemische Güter exportiert. Dazu braucht es internationale Regeln. Es wurden verschiedene Konventionen verabschiedet, um weltweit die gleichen Ziele der Vorsorge und des Gesundheitsschutzes zu erreichen. Zu nennen sind etwa das Stockholm-Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe oder das Übereinkommen von Minamata über Quecksilber. Zusätzlich gibt es auch Initiativen wie die 2006 unter dem Dach des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) lancierte Rahmenvereinbarung «Globale Chemikalienstrategie SAICM», die auf ein weltweit nachhaltiges Management von Chemikalien abzielt.
Herr Mumenthaler, wo stellen sich angesichts dieser Vielfalt von Regelungen für Sie als Vertreter der Produzenten die grössten Herausforderungen?
Mumenthaler: Aus unserer Sicht gilt es zu bedenken, dass die Analysetechniken und -verfahren immer präziser werden. Somit kann mittlerweile praktisch jeder Stoff überall nachgewiesen werden. Aber nur weil eine Substanz in der Umwelt ermittelt wird, sagt das noch nicht viel über die damit verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt aus. Daher sollte sich die Regulierung auf wissenschaftliche Erkenntnisse abstützen, wenn es darum geht festzulegen, welche Stoffe in welchen Mengen zulässig sind.
Für die Chemikaliensicherheit gibt es international ambitionierte Ziele; sind die damit verbundenen Vorschriften ein Problem für die Schweizer Industrie?
Mumenthaler: Die Schweiz hat eine eigene Chemikaliengesetzgebung, und die ist im globalen Vergleich auf einem sehr hohen Niveau. Der Gesetzgeber schaut natürlich zu Recht, wie sich die internationalen Normen entwickeln, damit die Kompatibilität gewährleistet ist. Gleichzeitig gilt es aber immer auch, ein gutes Verhältnis von Kosten und Nutzen einzuhalten. Zweifellos ist der Schutz von Mensch und Umwelt sehr wichtig, die Sicherheit muss indes zugleich mit Augenmass geregelt werden.
Chemische Produkte können nicht nur bei Herstellung und im Gebrauch problematisch sein, sondern auch als Abfall.

Chardonnens: In der Tat gehört die Entsorgung zum Lebenszyklus, denn auch wenn ein Produkt am Ende der Gebrauchsphase angelangt ist, verliert es nicht alle seine schädlichen Eigenschaften. Ein Beispiel dafür sind Schaumlöschmittel mit Fluortensiden, die zur Bekämpfung von Bränden mit flüssigen Treibstoffen in Löschanlagen von Grosstanklagern in erheblichen Mengen gelagert werden. Solche Schaumlöschmittel müssen nach Ablauf des Verfalldatums zu hohen Kosten in Hochtemperaturverbrennungen oder Zementwerken entsorgt werden, weil die persistenten Fluortenside das Grundwasser gefährden können. Früher wurden solche Schaumlöschmittel auch zu Übungszwecken von Feuerwehren verwendet, und die Fluortenside haben teilweise bei alten Übungsplätzen Boden und Wasser kontaminiert. Es gilt also, stets wachsam zu bleiben und nebst der Produktions- und der Gebrauchsphase auch die Entsorgung im Blick zu behalten.
Mumenthaler: Das Beispiel zeigt sehr schön die Nutzenseite: Der Schaum ist notwendig zur Brandbekämpfung in Lagern von hochentzündlichen Substanzen, und darum verwendet ihn die Feuerwehr. Wichtig ist nun, die Regulierung so auszugestalten, dass die Feuerwehr noch über Instrumente verfügt, um solche Brände zu löschen, denn funktionale Alternativen existieren nicht. Ein Verbot hätte zur Folge, dass ein Brand in einem grossen Tanklager nur mit Schwierigkeiten oder sogar überhaupt nicht mehr gelöscht werden könnte, was seinerseits ein erhebliches Umweltrisiko darstellen würde. Dabei ist es nicht die alleinige Aufgabe der Industrie, die fachgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Vielmehr stehen auch die Anwender in der Pflicht, die geschult werden müssen. Entsprechende Unterlagen werden von der Industrie zur Verfügung gestellt.
Chardonnens: Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass die Entsorgung im internationalen Kontext grosse Probleme aufwerfen kann. Ich erinnere an die Fässer mit den dioxinhaltigen Abfällen aus dem italienischen Seveso, die Anfang der 1980er-Jahre monatelang nicht mehr aufzufinden waren, und an weitere vergleichbare «Pannen». Die Schweiz hat sich dann 1985 stark für das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung eingesetzt. Trotzdem kam es nachher noch zu Schwierigkeiten, etwa, als schadstoffhaltige Schlacke aus einem Schweizer Aluminiumwerk zur Aufbereitung nach Portugal ausgeführt wurde.
Mumenthaler: Diese Beispiele bestätigen den Bedarf nach internationaler Koordination, denn die Normen dürfen sich von Land zu Land nicht zu stark unterscheiden. Wenn wir nur hierzulande streng regulieren, laufen wir Gefahr, bestimmte industrielle Aktivitäten, die heute in der Schweiz noch stattfinden, in andere Länder abzudrängen. Daher müssen wir uns einerseits international koordinieren und andererseits darauf achten, dass wir keine zu extremen Vorgaben machen.
Schweizer Firmen, die chemische Stoffe in die EU ausführen, müssen die Anforderungen von deren REACH-Verordnung erfüllen – also den Vorgaben zur Registrierung und Zulassung von Chemikalien entsprechen. Freut sich die Industrie über diesen wichtigen Schritt in Richtung internationaler Kohärenz?
Mumenthaler: Vieles an der europäischen Regulierung ist vernünftig, die Richtlinien zu Verpackung und Etikettierung – Stichwort CLP-Verordnung – übernehmen wir weitgehend automatisch. In anderen Bereichen aber sollten wir selektiver sein. Solange wir kein Mitglied der EU sind, sollten wir unseren Freiraum nutzen und Vorgaben beiseitelassen, die für unser Land und unsere Industrien gar nicht sinnvoll sind – zumal wir nicht nur eine Kundschaft in der EU beliefern. Wir sollten uns daher nicht nur an den europäischen Normen orientieren, sondern gegebenenfalls diejenigen anderer entwickelter Länder berücksichtigen, die ebenfalls gute Lösungen ausgearbeitet haben.
Wie sieht dies das BAFU als Umweltbehörde?
Chardonnens: Grundsätzlich sollten unsere Produkte durch ihre Qualität überzeugen und dieselben Standards hinsichtlich der Chemikaliensicherheit erfüllen wie in der EU. Die kontinuierliche Anpassung der Regulierung stellt allerdings hohe Ansprüche an den Vollzug. Die Entwicklung im Bereich der Chemikalien ist ja äusserst dynamisch, und um die Schutzziele in der ganzen Kette von der Produktion bis zur Entsorgung sicherzustellen, sind Bund wie auch Kantone gefordert. In der Schweiz versuchen wir, die Probleme gesamtheitlich anzugehen, damit wir sie nicht bloss vom einen Sektor in einen anderen verlagern, etwa von der Luft in den Boden. Wir müssen ganzheitliche Lösungen anstreben.
Mumenthaler: Gerade bei technischen Lösungen ist eine gesamtheitliche Sicht auch für uns wichtig: Verbesserungen im einen Bereich – zum Beispiel beim Reinigen der Abluft – führen nämlich oft zu Verschlechterungen in einem anderen Sektor, etwa beim Energieverbrauch und bei den CO2-Emissionen der dazu benötigten Anlagen. Man braucht eine gute Datenbasis, um zu ermitteln, welche Lösung der Umwelt gesamthaft am meisten bringt. Um hier weiterzukommen, suchen wir den Kontakt zum BAFU. Chardonnens: Darin liegt sicher auch eine Stärke der Schweiz: Dass hierzulande das direkte Gespräch der Konfrontation vorgezogen wird, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.
Behörde trifft Wirtschaft
Marc Chardonnens schloss sein Studium als Ingenieur-Agronom an der ETH Zürich ab und erwarb zudem am Institut des Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP) der Universität Lausanne den Titel eines Master of Public Administration. Nachdem er über 10 Jahre das Amt für Umwelt in der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion des Kantons Freiburg geleitet hatte, ernannte ihn der Bundesrat im Januar 2016 zum Direktor des BAFU.
Stephan Mumenthaler ist Ökonom und promovierte an der Universität Basel im Bereich Aussenhandel. Nach verschiedenen Stationen in Verwaltung, Beratung und Industrie im In- und Ausland ist er seit Anfang Mai 2018 als Direktor bei scienceindustries tätig – dem Verband Chemie Pharma Biotech der Schweiz.
Weiterführende Informationen
Letzte Änderung 28.11.2018