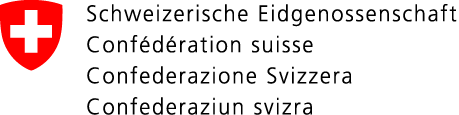Für die Lösung von Umweltproblemen wie dem Klimawandel und der Biodiversitätskrise bietet die Umweltökonomiewirksame Hebel. Kein Wunder also, hat diese in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Zunehmend rückt auch die Entkopplung des Ressourcenverbrauchs vom Wirtschaftswachstum in den Fokus.
Text: Gregor Klaus
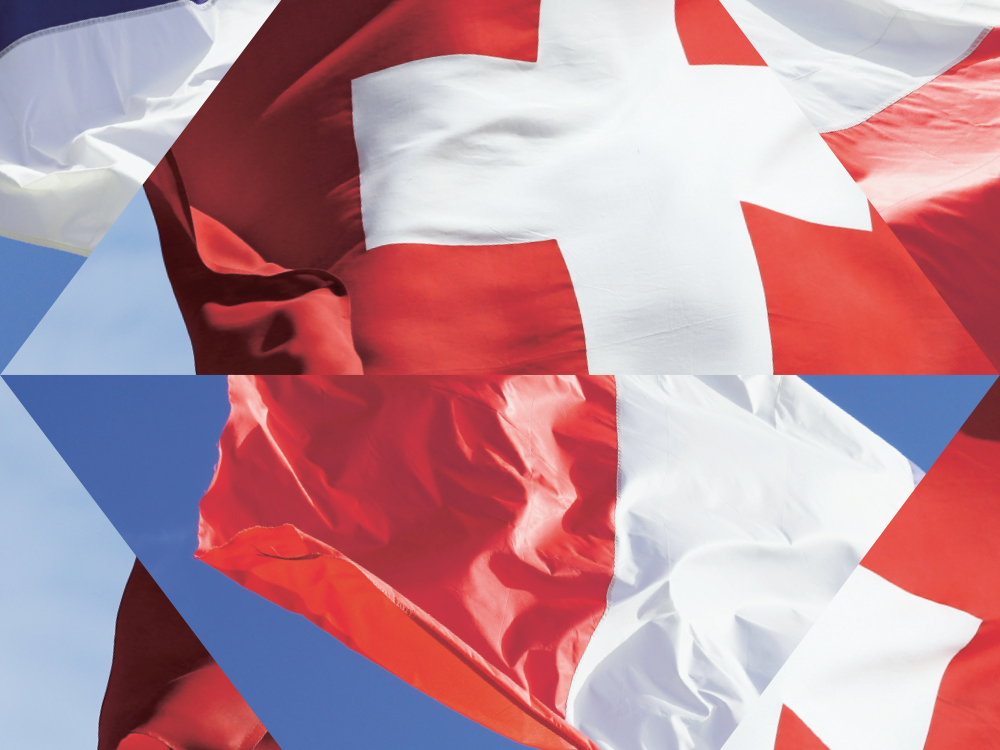
Die Peperoni glänzen in satten Farben im Regal und laden zum Kaufen ein. Was man nicht sieht: Den hohen Wasserverbrauch beim Anbau, die schlechten Arbeitsbedingungen der Arbeitenden, den Pestizid- und Düngereinsatz, die langen Transportwege. Die Preise der Produkte, die wir täglich kaufen, widerspiegeln offenbar die Schäden nicht, die an öffentlichen Gütern entstehen. Unser Konsum nimmt weiter zu, die globalen Umweltprobleme ebenso. Die Umweltökonomie erklärt dies mit Marktversagen. Eines ihrer wichtigsten Instrumente für die Lösung der Umweltprobleme ist die Internalisierung (also der Einbezug) der Kosten, die durch die Verschmutzung des Wassers und der Luft, die Degradierung des Bodens, die Störung der Ruhe, den Verlust der Biodiversität und den Klimawandel für die Gesellschaft entstehen.
Funkenbrand als Initialzündung
Dass durch ökonomische Aktivitäten Schäden für Dritte entstehen können, die ihnen vom Verursacher nicht abgegolten werden, hat der englische Ökonom Arthur Cecil Pigou erstmals aufgezeigt. In den 1920er-Jahren stellte er fest, dass kohlebetriebene Eisenbahnen Funkenbrände auf Feldern neben den Gleisen verursachen – die Landbesitzenden aber nicht entschädigt werden. Die Eisenbahngesellschaft müsse für die Schäden aufkommen, so Pigou. Dieses Konzept wurde ab den 1970er-Jahren auf die Umweltökonomie übertragen.Die Theorie klingt bestechend einfach, und man fragt sich, wieso sie nicht schon längst in die Tat umgesetzt wurde. Ein Blick in die methodischen und politischen Realitäten gibt Antworten. Zunächst einmal ist es alles andere als einfach, Schäden zu berechnen. Im Fall des Funkenbrandes mag es vergleichsweise einfach sein. Aber den Nutzen einer intakten Umwelt, die durch Verschmutzung verloren geht, in konkreten Geldbeträgen auszudrücken, ist schon schwieriger. Nochmals anspruchsvoller wird es, wenn es um Schäden und Nutzen in der Zukunft geht.
Es gibt zwar zahlreiche Studien zu Monetarisierungen, aber bisher ist ihr Einfluss auf die Politik begrenzt. Eine bekannte Arbeit stammt aus dem Jahr 1997 und hatte zum Ziel, den Wert der Natur für den Menschen zu erfassen. Man kam auf einen globalen Nutzen der Ökosysteme von 16 bis 54 Billionen US-Dollar pro Jahr – und damit in der Grössenordnung des globalen Bruttoinlandprodukts. «Diese Zahlen hatten eine grosse politisch-gesellschaftliche Aussagekraft», sagt Irmi Seidl, Leiterin der Forschungseinheit für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Es habe aber auch massive Kritik gegeben: Unter anderem sei moniert worden, die Natur sei die Lebensgrundlage der Menschen und lasse sich nicht beziffern.
Zahlen und Geldwerte
Irmi Seidl hat 1999 in einem Fachartikel auf die Risiken und Chancen von Monetarisierungen hingewiesen. Damit diese sinnvoll und vertretbar seien, müssten ökologische, ethische, politische und ökonomische Überlegungen und Kriterien herangezogen werden, schrieb die Forscherin damals. Heute zieht sie Bilanz: «Die Methoden wurden in den letzten beiden Jahrzehnten weiterentwickelt und kritisch diskutiert. Zum Teil werden die Zahlen in der Politik beigezogen. Grundsätzliche Probleme bleiben aber bestehen, weil das Wissen um ökologische Zusammenhänge zwangsläufig lückenhaft bleibt, viele Märkte für Leistungen der Natur hypothetisch sind und Menschen gar nicht immer ökonomisch denken. Bevölkerung und Politik möchten nun einmal Zahlen und Geldwerte sehen, auch wenn solche Berechnungen mit guten Argumenten angezweifelt werden können.»
Halbherzige Internalisierung
Das BAFU verwendet zwar Resultate aus Monetarisierungsstudien, allerdings nur ganz gezielt – und das Amt ist sich der methodischen Probleme bewusst. Susanne Blank, Chefin der Abteilung Ökonomie und Innovation beim BAFU, weist darauf hin, dass die Studien methodisch sauber aufgegleist und die Resultate richtig kommuniziert werden müssen, um Missverständnisse zu vermeiden. «Die Preise und Marktmechanismen müssen dem bewerteten Gut gerecht werden», sagt sie. Wie Irmi Seidl gibt sie zu bedenken, dass gesellschaftliche und ethische Werte, die Menschen beispielsweise der Natur zuschreiben, bei der Monetarisierung verloren gehen.
Bis heute sind Preiskorrekturen aufgrund errechneter Umweltschäden selten. «Ein verbreiteter Grund, weshalb sogenannte Internalisierungen kaum realisiert werden, ist die Befürchtung, dass die Wirtschaft Schaden nehmen könnte», erklärt Irmi Seidl. «Umweltpolitik wird also unter Wachstumsvorbehalt gestellt. Das führt dazu, dass falsche Preissignale fortbestehen können.»
Die Krux mit dem Wachstum
Weil die Berechnung von Umweltschäden und vor allem die Internalisierung nur langsam vorankommen, rückt zunehmend die Frage der Entkopplung des Ressourcenverbrauchs vom Wirtschaftswachstum in den Fokus. Hier hat das BAFU gute Grundlagen für die anstehenden Debatten geschaffen. Dazu gehören die Untersuchungen zu den Materialflüssen und den Lieferketten, die gezeigt haben, dass mittlerweile rund zwei Drittel der durch die Schweiz verursachten Umweltschäden im Ausland anfallen. Wichtig war auch, dass die planetaren Grenzen auf die nationale Ebene heruntergebrochen wurden. Das Resultat: Würden alle Menschen so leben wie wir, bräuchte es aufgrund unseres überdurchschnittlichen Ressourcenverbrauchs mehr als drei Erden. Der 11. Mai 2021 war der diesjährige Overshoot Day der Schweiz: Vom 1. Januar bis zum 11. Mai hat nämlich die Bevölkerung so viel von von den natürlichen Ressourcen verbraucht, wie der Planet im ganzen Jahr erneuert. Damit die Schweiz wieder innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaftet, bräuchte es neben der Technologieentwicklung vor allem gesellschaftliche Transformationsprozesse.
Was unweigerlich zur Frage nach alternativen Entwicklungsmöglichkeiten führt. Irmi Seidl ist überzeugt, dass die Unabhängigkeit vom Wirtschaftswachstum ein zentrales Element dabei sein muss. Denn bislang habe die ökonomische und gesellschaftliche Abhängigkeit vom Wirtschaftswachstum eine wirkungsvolle Umweltpolitik verhindert und damit auch die Internalisierung von externen Kosten, obwohl darüber ein breiter Konsens in der Ökonomie bestehe.
Bei einer Abkehr von der Wachstumsorientierung stellen sich allerdings gewichtige Fragen: Wenn Produkte wie Staubsauger und Mixer plötzlich dreimal so lange halten wie bisher, bräuchte es nicht nur dreimal weniger Ressourcen, sondern auch dreimal weniger Ladenfläche und Verkaufspersonal. Doch wie sollen diese Menschen dann erwerbstätig sein? «Diese Fragen müssen wir uns stellen und Perspektiven aufzeigen», sagt Susanne Blank vom BAFU. «So würde die Reparaturbranche vermutlich deutlich gefragter sein als heute. Dies schafft Arbeitsplätze, und zwar vor allem im Inland.»
Subventionen im Fokus
Bis dahin ist es aber noch ein steiniger Weg. Derweil könnte ein wichtiger Hebel, nämlich die Finanzpolitik, schon bald wirken. Susanne Blank weist darauf hin, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter dem Stichwort «green budgeting» den Staaten empfiehlt, gezielt Instrumente der Haushaltspolitik anzuwenden, um Umwelt- und Klimaziele zu erreichen. Irland, Norwegen und Frankreich nehmen hier bereits eine Vorreiterrolle ein.
Die Schweiz ist zurzeit dabei, die bestehenden Subventionen in Bezug auf ihre schädigende Wirkung auf die Biodiversität zu untersuchen. Forscherin Irmi Seidl hat dazu mit ihrer Kollegin Lena Gubler und zusammen mit dem Forum Biodiversität Schweiz im vergangenen Jahr eine erste Analyse vorgelegt. In dieser Studie wurden gut 160 Subventionen identifiziert, die unterschiedlich stark biodiversitätsschädigend wirken. Gewährt werden sie in den Bereichen Verkehr, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energieproduktion und -konsum, Siedlungsentwicklung, Tourismus, Abwasserentsorgung und Hochwasserschutz. «Viele dieser Geldströme sind ökonomisch ineffizient und sollten deshalb umgestaltet, reduziert, teilweise auch aufgehoben werden», erklärt Seidl. Die Studie dient dem BAFU als Ausgangspunkt für die Bewertung der vielfältigen Subventionen unter dem Aktionsplan Biodiversität. Bis 2023 werden Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf die Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie und Soziales) aufgezeigt. «In Zusammenarbeit mit anderen Ämtern arbeiten wir daran, falsche Anreize zu korrigieren», sagt Susanne Blank.
Letzte Änderung 01.09.2021