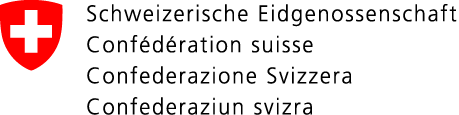Die Umweltpolitik des Bundes kann auf eine Vielzahl von Instrumenten zugreifen, um ihre Ziele zu erreichen. Mit dem Nudging – dem Anstupsen – ist ein elegantes, viel gepriesenes Mittel hinzugekommen: Ohne Verbote oder Gebote lassen sich damit gewünschte Verhaltensänderungen herbeiführen. Allerdings ist «nudging» nicht in jedem Bereich angemessen.
Text: Nicolas Gattlen
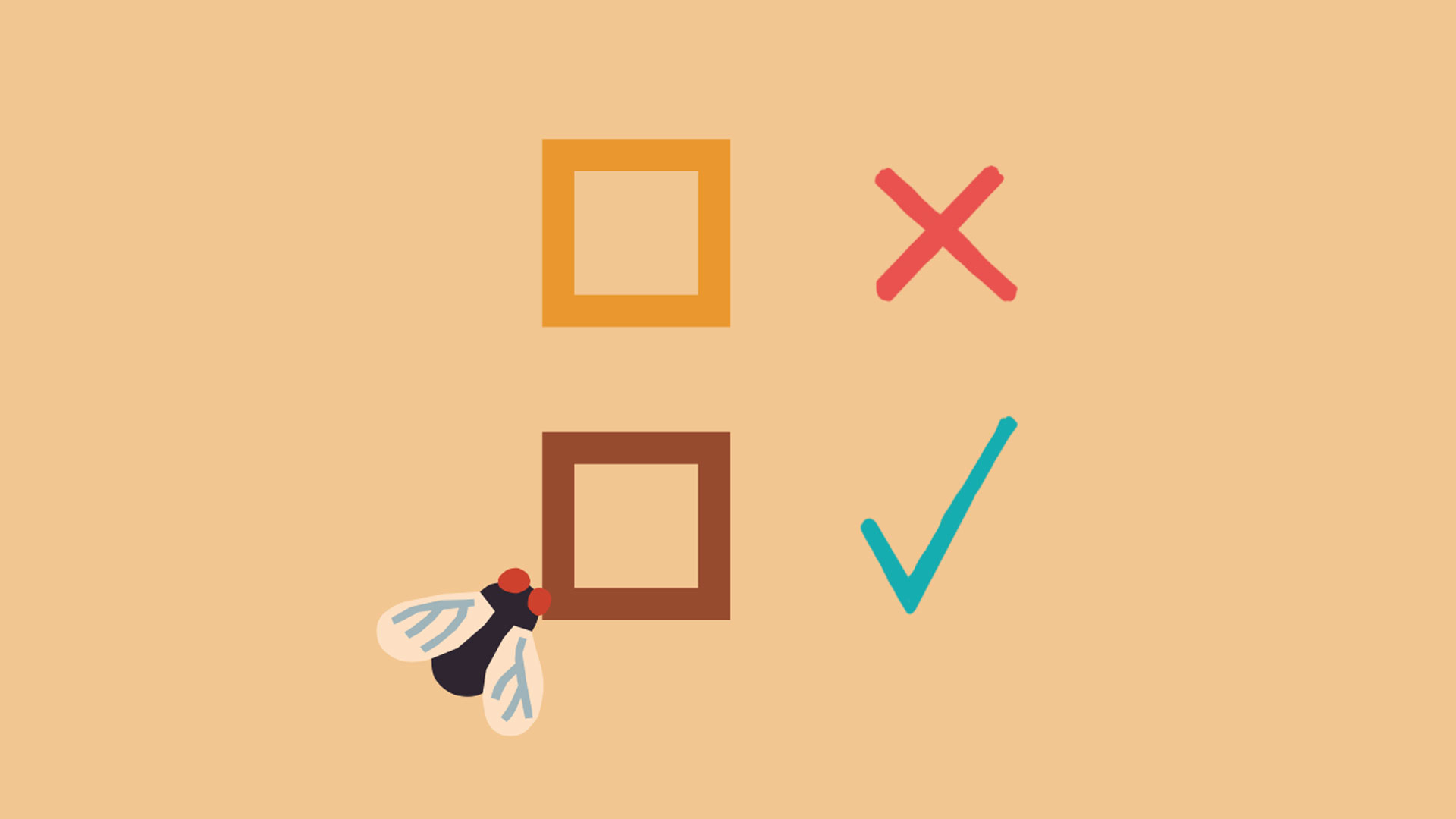
Eigentlich sollten wir alle ein grosses Interesse daran haben, der Umwelt Sorge zu tragen, ist doch der Umweltschutz – auch rein ökonomisch – auf längere Sicht vorteilhafter als eine Welt voller ökologischer Schäden. Im Alltag aber scheinen wir dieses Interesse gern auszublenden. Auch wenn uns die negativen Folgen bekannt sind, entscheiden wir uns beim Einkauf doch für umweltschädigende Produkte, fahren mit dem Auto ins nahe Sportcenter und verlängern das konventionelle Strommix-Abo. Warum aber handeln wir so?
Hitzig gegen rational
Die Verhaltensökonomie hat darauf zahlreiche Antworten gefunden. Einer ihrer prominentesten Vertreter, der Amerikaner Richard Thaler, wies beispielsweise nach, dass Menschen aufgrund von «kognitiven Einschränkungen» dazu neigen, die kurzfristigen Auswirkungen stärker zu gewichten als die in fernerer Zukunft liegenden Folgen. Zugleich stellte er einen «Mangel an Selbstkontrolle» fest: In unserem Gehirn ringe der «hitzköpfige Macher» mit dem «rationalen Planer». Ersterer denke eher kurzfristig, sei ungeduldig und handle spontan; Letzterer verfolge langfristige Interessen und fälle Entscheidungen nach reiflicher Überlegung. Es sei ein Kampf, den allzu oft der «hitzköpfige Macher» gewinne.
Just dieser Hitzkopf lässt sich auch zum Guten nutzen, glaubt Richard Thaler, der für seine Forschungsarbeiten 2017 den Nobelpreis erhielt. Man müsse nur die Entscheidungsumgebung so gestalten, dass sie unser spontanes Tun in die gewünschte Richtung lenkt.
Veränderte Voreinstellung
Bereits in den 1990er-Jahren konnte Thaler aufzeigen, dass sich mit einer winzigen Systemänderung der Lebensabend von Millionen von Menschen verbessern lässt. Ihm war aufgefallen, dass sich viele Amerikanerinnen und Amerikaner davor drücken, einen Teil ihres Lohns in die betriebliche Altersvorsorge zu investieren – auch wenn sie es sich leisten konnten. Also entwickelte er ein sogenanntes Opting-out-Modell: Statt dass sich die Arbeitnehmenden aktiv für die Teilnahme an der betrieblichen Vorsorge entscheiden mussten (Opting-in), war die Teilnahme nun als Standard vorgegeben. Wer ihn nicht übernehmen wollte, musste sich aktiv dagegen entscheiden. Bald darauf stieg die Teilnahmequote von knapp 50 auf 85 Prozent. In der Fachwelt hat sich für den Einsatz von verhaltensökonomischen Instrumenten wie dem Setzen von Vorgabewerten (Default) der Begriff Nudging etabliert, zu Deutsch: einen Anstoss geben, stupsen. Richard Thaler und der amerikanische Rechtswissenschaftler Cass Sunstein verwendeten den Begriff erstmals in ihrem 2008 erschienenen Bestseller «Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstösst». Darin führen sie interessante und auch überrasch ende Praxisbeispiele auf: So verbesserten Kinder ihre Schulleistungen, nachdem man ihnen den Wert einer guten Ausbildung anhand des Unterschieds zwischen einem Kleinwagen und einem Luxusgefährt dargestellt hatte. Ein Spiegel hinter dem Buffet bewog Kantinenbesuchende dazu, zu Früchten statt Donuts zu greifen. Und in zahlreichen Experimenten zeigte sich, dass Menschen umweltbewusster handeln, wenn sie wissen, dass ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger ebenfalls umweltbewusster leben.
Hype um «libertären Paternalismus»
Im angelsächsischen Raum griff die Politik die Ideen des Nobelpreisträgers mit Begeisterung auf: US-Präsident Barack Obama gründete, wie auch der britische Premier David Cameron, eine eigene Nudging-Einheit innerhalb der Verwaltung. Rasch folgten Dutzende weitere Staaten und öffentliche Einrichtungen. Es entstand – auch in Umweltschutzkreisen – ein richtiggehender Hype um dieses neue Polit-Tool, das Richard Thaler und Cass Sunstein als «libertären Paternalismus» verkauften: Der Staat lenkt, ohne Verbote und Gebote. Niemand wird zu etwas gezwungen, man wird nur gestupst, zum eigenen Vorteil.
Allerdings erntet das Konzept auch Kritik: Kann der Staat mit Sicherheit wissen, was die langfristig optimale Entscheidung für das Individuum ist? Und kann er sicher sein, dass das «Vernünftige» stets das Bessere für die geschubste Person ist? Ein Raucher etwa mag sich der Gesundheitsrisiken bewusst sein und mit seiner Sucht hadern, vielleicht aber hilft ihm das Rauchen, Stress abzubauen, soziale Kontakte zu pflegen und zufriedener zu leben. Was Thaler als irrationale «Fehlentscheidung» bewertet, die es zu korrigieren gilt, kann für die einzelne Person durchaus sinnvoll und beglückend sein.
Der «Nannystaat»
Umstritten ist auch die Annahme, dass es in der Natur des Menschen liegt, «Fehlentscheidungen» zu treffen, und dass es deshalb äusserer Eingriffe bedarf – und zwar permanent, weil wir nun einmal unverbesserliche Mängelwesen sind. Gerd Gigerenzer, emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin, kritisiert, dass mit Nudging versucht werde, Menschen von aussen zu steuern, ohne ihre Kompetenzen zu erhöhen. Man kenne das aus der DDR, wo die Bürgerinnen und Bürger «von der Wiege bis zur Bahre» geschoben worden seien. Die Folge: Der «Nannystaat» ziehe unmündige Menschen heran, die kaum noch fähig oder willens seien, sich mit ihren Problemen oder mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen und selbstständig Entscheidungen zu fällen.
Gewarnt wird zudem vor dem steigenden Konformitätsdruck, den der sanfte Paternalismus erzeuge. Würden beispielsweise Autos mit Aufklebern bestückt, die den Treibstoffverbrauch zeigen, müssten die «Umweltsünder» fürchten, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Am Ende wären wir ein Volk «unerträglich braver Spiesser», meint Jan Schnellenbach, Wirtschaftswissenschaftler an der Technischen Universität in Cottbus.
Demokratisch legitimierte Ziele
Diese Kritiken greifen allerdings ins Leere, wenn staatliche Behörden das Nudging als Mittel einsetzen, um das Gemeinwohl zu stärken oder Schaden an Dritten abzuwenden – Ziele, die durchaus mit den Präferenzen des Einzelnen kollidieren können. Dass der Staat eine Verhaltensänderung der Bürgerinnen und Bürger herbeiführen will, ist nichts Neues, jedes Polit-Instrument zielt darauf ab. Philipp Röser, der sich in der Sektion Ökonomie des BAFU mit Regulierungsfragen befasst, hält das Nudging denn auch für ein berechtigtes Instrument – «unter der Voraussetzung, dass die Ziele demokratisch legitimiert sind, der gesetzgeberische Prozess eingehalten und das Vorgehen offen kommuniziert wird».
Auch gilt es von Fall zu Fall abzuklären, ob Nudging das angemessene Instrument ist, um das angestrebte Ziel zu erreichen. «In Bereichen wie dem Klima- und dem Biodiversitätsschutz etwa ist der Handlungsbedarf so gross, dass hier in erster Linie andere Instrumente eingesetzt werden müssen», erklärt Philipp Röser. Nudging komme höchstens als Ergänzung infrage. Tatsächlich wird die Wirkungsmacht dieses Instruments oft überbewertet: Erstens zielt es in der Regel nur auf Individuen, zweitens funktioniert es vor allem in denjenigen Bereichen, die keine grossen Anstrengungen oder Opfer erfordern. Kaum jemand lässt sich durch Nudging vom Fliegen abbringen. Es sind die tiefhängenden Früchte, die sich damit ernten lassen. Sie können ein wichtiger Beitrag sein, reichen aber nicht, um die Klima- und Biodiversitätsziele zu erreichen. Würde die Politik hier allein auf Nudging setzen, würde sie ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl und die nachfolgenden Generationen nicht gerecht werden.
Verhaltensökonomie im Dienste des Umweltschutzes
Um die Ziele der Umweltpolitik zu erreichen, stehen dem Bund rund 30 Instrumente zur Verfügung – von freiwilligen Vereinbarungen über Infokampagnen und finanzielle Anreize bis zu Geboten und Verboten. Mithilfe der Verhaltensökonomie lässt sich die Effektivität dieser Instrumente deutlich verbessern. Im Vergleich zum standardökonomischen Ansatz, bei dem menschliches Verhalten oft mit monetären Kosten-Nutzen-Abwägungen begründet wird, berücksichtigt der verhaltensökonomische Ansatz weitere Faktoren zur Erklärung menschlichen Verhaltens. So werden unter anderem Gewohnheiten, Werte, soziale Normen sowie Status- und Zeitpräferenzen als wichtige Treiber miteinbezogen. Diese können einen bedeutenden Einfluss auf die Wirkung einer Massnahme haben. Innerhalb des BAFU verfügt die Sektion Ökonomie über das entsprechende Fachwissen; sie bietet den verschiedenen Abteilungen des Amtes Beratungen an.
Verhaltensökonomische Instrumente wie das Nudging werden derzeit in der Umweltpolitik des Bundes nicht eingesetzt, obschon die rechtlichen Grundlagen dies ermöglichen. Genutzt wird die Methode hingegen von mehreren Schweizer Stadtwerken: Sie haben ihre Voreinstellung (Default) auf einen «grünen» Strommix festgelegt, der aus einem grösseren Teil an Ökostrom besteht, dafür aber etwas teurer ist. Wer günstigeren – und weniger umweltfreundlichen – Strom beziehen möchte, kann dies tun, muss aber die Voreinstellung ändern. Die Statistiken der Stadtwerke zeigen, dass zwischen 70 und 85 Prozent der Haushalte den Default-Wert unverändert lassen.
Weiterführende Informationen
Letzte Änderung 01.12.2021