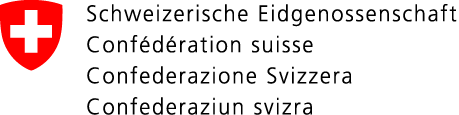Wie ernst es um unser Klima steht, ist längst bekannt. Ebenso, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Trotzdem passiert noch immer viel zu wenig. Wo also liegt der Schlüssel, der den notwendigen Wandel herbeiführt? Umweltschutzpionier Peter Lüthi (64) und Umweltpsychologin Tabea Pusceddu (33) im Gespräch über eine vielschichtige Herausforderung.
Interview: Ramona Nock

© Yoshiko Kusano/Lunax/BAFU
Tabea Pusceddu

© Yoshiko Kusano/Lunax/BAFU
Tabea Pusceddu (33) studierte Arbeits- und Organisationspsychologie und arbeitete danach in der Personal- und Organisationsentwicklung. Aktuell macht sie ihren Masterabschluss in Wirtschaftspsychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ihr Schwerpunkt ist Umweltpsychologie – sie interessiert sich für die Frage, wie man Menschen zu einem nachhaltigeren und bewussteren Konsumverhalten motivieren kann. Pusceddu engagiert sich im Vorstand des Vereins für Umweltpsychologie Schweiz.
Peter Lüthi

© Yoshiko Kusano/Lunax/BAFU
Peter Lüthi (64) war von 1984 bis 1989 Bildredaktor, Redaktor und Umwelterzieher beim WWF Schweiz sowie bis 2000 Regionalkoordinator beim WWF Graubünden. Danach baute er mit Gleichgesinnten Biovision, eine Stiftung für Umwelt und Entwicklung, auf. Dort amtet er heute im freien Mandat als Text- und Fotoreporter. Lüthi verbrachte 25 Sommer als Hirte mit Rindern, Schafen, Ziegen, Pferden und Eseln auf Bündner Alpen.
Peter Lüthi, Sie haben die Schweizer Bevölkerung schon in den 1980er-Jahren über Umweltschutz informiert, als die Gefahren des Klimawandels noch kaum bekannt waren. Wie sind Sie vorgegangen?
Peter Lüthi: Als ich 1984 beim WWF begann, haben wir uns etwa wegen des Waldsterbens, gegen die Atomenergie oder den Nationalstrassenbau engagiert. Damit ernteten wir einerseits Applaus – und bezogen andererseits Prügel. Es gab Leute, die fanden, der WWF solle Tiger und Elefanten schützen, sich aber nicht in die Schweizer Umweltpolitik einmischen. Beim WWF Graubünden habe ich mich später vor allem für den Landschafts- und Biotopschutz und gegen die Zerstörung von Gewässern durch Kraftwerke eingesetzt – von der Greina bis zur Val Curciusa. Letztere haben wir bis vor Bundesgericht verteidigt. Und mit Kampagnenarbeit und Medienaktionen haben wir öffentlichen Druck aufgebaut.
Wie sahen diese Aktionen aus?
PL: Wir haben zum Beispiel geplante Staudämme in bedrohten Landschaften mit Girlanden aus Hunderten Luftballons markiert und originelle Demos gemacht – unter anderem einen «Unterwasseralpaufzug» mit Kühen und Ziegen auf der Zürcher Bahnhofstrasse für das Val Madris. Dieses Bergtal samt zwei Alpen sollte mit einem neuen Stausee überflutet werden, der produzierte Strom wäre aber ins Mittelland und ins Ausland geflossen. Das Medienecho war gross, selbst die Tagesschau berichtete. An der Urne unterlagen wir jedoch mit vielen Energie-Initiativen. Rückblickend waren diese Abstimmungskampagnen trotzdem wichtig für die öffentliche Meinungsbildung und damit wirksame Vorläufer für die Klimajugend von heute. Diese ist für mich übrigens ein grosser Aufsteller. Sie erreichte, was wir damals nicht wirklich schafften: Heute nehmen selbst bürgerliche Parteien Themen wie den Klimawandel, die CO2-Neutralität oder die Förderung der Solarenergie auf.
Was hat die Klimajugend richtig gemacht?
PL: Sie nutzte ihre direkte Verbindung zur Generation ihrer Eltern. Wenn etwa eine junge Frau ihrem Vater – bestenfalls einem Politiker – sagt, es gehe hier um ihre eigene Zukunft, ist er persönlich betroffen und gefordert. Diese emotionale Nähe wirkt stärker als unsere Aktionen von damals.
Tabea Pusceddu, Sie sind Umweltpsychologin. Fehlt uns das Bewusstsein über die Folgen der Klimaerwärmung?
Tabea Pusceddu: Das kann sein. Aus psychologischer Sicht kommt hier häufig auch ein Selbstschutz ins Spiel: Wenn wir alles, was wir wahrnehmen, auf uns einprasseln lassen würden, gingen wir zugrunde. Wir schützen uns also, indem wir eine Tatsache wie den Klimawandel verharmlosen oder verdrängen. Es spielt aber auch mit, dass die Klimakrise ein sehr komplexes und globales Problem ist. Die Folgen unseres Handelns sind erst viel später spürbar, vielleicht an einem anderen Ort auf der Welt. Darum tendieren wir dazu, das Problem unbewusst kleinzureden, es vielleicht sogar als Angstmacherei abzutun.
PL: Mich erstaunt das aber trotzdem: Wenn wir heute in den Nachrichten mehrfach erfahren, die Emilia Romagna stehe wegen der Wetterextreme unter Wasser, so kann es doch nicht an mangelndem Bewusstsein liegen. Trotzdem findet mehrheitlich keine Verhaltensänderung statt.
TP: Tatsächlich könnte man annehmen, die Leute müssten über ein Problem nur informiert sein, dann unternehmen sie auch etwas dagegen. Aber zwischen Wissen und Verhalten ändern geschieht noch sehr viel anderes. Man fühlt sich machtlos – denkt, man selbst könne nicht viel dagegen ausrichten. Auch Bequemlichkeit spielt eine Rolle. Wenn die eigenen Werte nicht mehr mit dem gewünschten Verhalten übereinstimmen, entsteht ein unangenehmer Spannungszustand, den man in der Psychologie als kognitive Dissonanz bezeichnet. Ich möchte zwar die Umwelt schützen, aber trotzdem in den Ferien nach Hawaii fliegen. Also suche ich nach einer Rechtfertigung, indem ich sage: Ich fahre ja kaum Auto, da kann ich mir so einen Langstreckenflug gönnen. Man täuscht sich also selbst, um wieder mit sich im Reinen zu sein.
Würden Massnahmen helfen, die uns persönlich schmerzen – wenn etwa Flugtickets massiv mehr kosten würden?
TP: Der Preis hat auf jeden Fall einen Einfluss. Solange Flüge viel günstiger sind als Zugreisen in Europa, muss die eigene Überzeugung sehr gross sein, zu sagen: Ich nehme in Kauf, für eine Reise mehr zu bezahlen und zusätzlich mehr Zeit aufzuwenden. Wenn umweltfreundliche Varianten nicht günstiger sind oder wenigstens gleich viel kosten, bringt man die Mehrheit der Bevölkerung nicht dazu, umzusteigen.
PL: Nach meiner Erfahrung sind das Portemonnaie und entsprechende politische Rahmenbedingungen die wirksamsten Hebel, um das Verhalten der Masse zu beeinflussen. Es bräuchte dringend einen Paradigmenwechsel und Kostenwahrheit. Beispiel Ernährung: Warum sind Bioprodukte teurer als konventionelle? Es müsste doch umgekehrt sein!
Mit Anliegen wie einer Flugticketabgabe finden Sie aber keine politischen Mehrheiten. Muss die Kommunikation über den Klimawandel angepasst werden, damit sich unser Verhalten ändert?
PL: Das Wissen über Ursachen und Folgen des Klimawandels und der Biodiversitätskrise ist breit vorhanden. Sie sind minutiös dokumentiert, und doch werden die Konsequenzen nicht wirklich gezogen. Was also fehlt? Meiner Meinung nach ist es der emotionale Bezug. Emotionen wären ein wichtiger Schlüssel in der Kommunikation zur Verhaltensänderung.
Inwiefern?
PL: Was man liebt, das schützt man. Einfach gesagt: Wenn ich «Jöh-Bilder» von Lieblingstieren zeige, die wegen des Klimawandels aussterben, oder von Familien in Afrika, die heute ums Überleben kämpfen müssen, kann das – so hoffe ich – eine Verhaltensänderung auslösen.
TP: Emotionen zu wecken, ist sicher wichtig. Damit wir uns aber nicht nur hilflos und ohnmächtig fühlen, braucht es konkrete Vorschläge. Damit jeder für sich weiss, was er oder sie persönlich tun kann. Einen grossen Einfluss hat zudem das soziale Umfeld. Wir wollen dazugehören und nicht anecken. Wenn man also im Freundeskreis plötzlich die einzige Person ist, die noch Fleisch isst oder viel mit dem Auto statt den ÖV fährt, hinterfragt man irgendwann das eigene Verhalten, weil man nicht negativ auffallen möchte.
Haben Sie hierzu eigene Erfahrungen gemacht?
TP: Ich habe gemerkt: Wer umwelt- und klimafreundlich lebt, wird automatisch darauf angesprochen. Beschliesst man also: Ich koche für unsere Gäste vegan, oder an diesem Hochzeitsfest in Griechenland möchte ich nicht teilnehmen, denn die Flugreise belastet das Klima, dann weckt dies das Interesse der Mitmenschen. Man beginnt, sich über seine Werte zu unterhalten. Wir müssen gar nicht moralisieren oder versuchen, den anderen etwas aufzuzwingen.
Sie haben gesagt, es brauche konkrete Tipps, wie wir im Alltag klimafreundlicher leben. Warum?
TP: Weil das die Selbstwirksamkeit stärkt. Man fühlt sich nicht nur ohnmächtig und denkt, auf mich kommt es sowieso nicht an, sondern erfährt, dass jede noch so kleine Verhaltensänderung zählt. Ich glaube, die meisten Menschen wollen die Umwelt schützen, fühlen sich aber einfach überfordert, da sie nicht wissen, wo die grossen Hebel liegen und was tatsächlich hilft. Man muss die Leute zum Handeln bringen – wobei mir wichtig ist zu sagen, dass die Verantwortung nicht nur beim Individuum liegt, sondern auch bei der Politik. Wobei diese wiederum von Menschen gemacht ist.
Hilft es, verschiedene Generationen unterschiedlich zu sensibilisieren?
TP: Jugendliche suchen noch nach ihrer Identität – daher lässt sich bei ihnen mehr ändern als bei älteren Personen. Diese wiederum sind vielleicht nicht mehr bereit, den gewohnten Lebensstandard aufzugeben. Ein Ansatz wäre, an das Verantwortungsbewusstsein für ihre Nachkommen zu appellieren. Zu verdeutlichen, dass es beim Klimaschutz um die Zukunft ihrer Enkelinnen und Enkel geht. Generell ist es wichtig, zielgruppengerecht zu kommunizieren. Etwa zu berücksichtigen, welches Wissen über den Klimawandel man voraussetzen kann.
PL: Die Kommunikationskanäle sind für die verschiedenen Generationen zweifellos unterschiedlich. Was aber bei allen Altersgruppen anzusprechen wäre, sind wie gesagt emotionale Bezüge zur Natur und Landschaft. Wenn etwa jemand an einem lauschigen Bach sitzt und erfährt, dass dieser demnächst für die Stromproduktion zerstört wird, müsste es doch «Klick» machen.
TP: Es ist sicher ein Problem, dass die Menschen zunehmend in Städten oder Agglomerationen leben und damit das Naturerlebnis fehlt. Was ich aber feststelle: Personen in meinem Alter oder auch jüngere werden durch Kanäle wie Netflix sensibilisiert. Dies anhand von Serien oder Dokus, die veranschaulichen, was mit dem Klimawandel alles in Gefahr ist, und gleichzeitig darlegen, was man gegen die Problematik tun kann.
Müssten Appelle zu klimafreundlichem Verhalten präsenter sein in unserem Alltag?
TP: Ich finde, ja: Der Klimawandel ist eine Riesenbedrohung und bekommt in den Medien zu wenig Platz.
PL: Ich meine, der Klimawandel ist bereits omnipräsent in den Medien und in der Öffentlichkeit. Was fehlt, ist der Schritt zur eigenen Verhaltensänderung. Mich macht die heutige Situation ziemlich ratlos. Die Schweiz verzeichnete am 13. Mai den «world overshoot day»: Bis zu diesem Tag haben wir die Ressourcen, die uns fürs ganze Jahr zur Verfügung stehen müssten, bereits aufgebraucht. Unser Land gehört punkto Biodiversität zu den Schlusslichtern Europas. Trotzdem steuern wir – insbesondere die Mehrheit der nationalen Politikerinnen und Politiker, die im Parlament den Natur-, Biotop- und Gewässerschutz zugunsten der Energieproduktion aushebeln – genau in die falsche Richtung. Ich finde das mutlos, kurzsichtig und unverantwortlich. Denn mit der Klimakrise rollt ja bereits auch die Biodiversitätskrise heran. Zusammen stellen sie die Zukunft kommender Generationen ernsthaft infrage.
Weiterführende Informationen
Letzte Änderung 29.11.2023