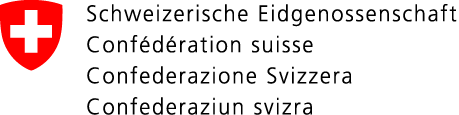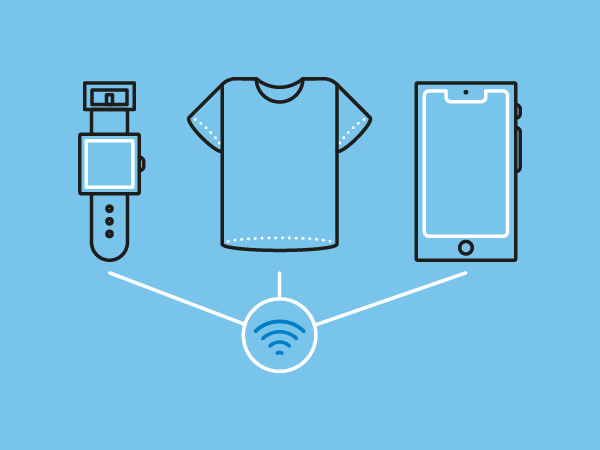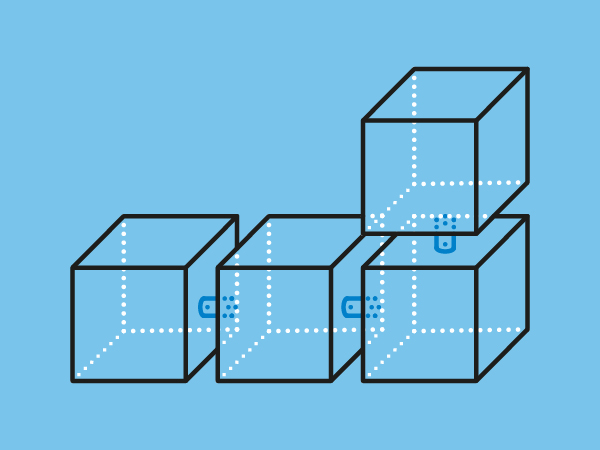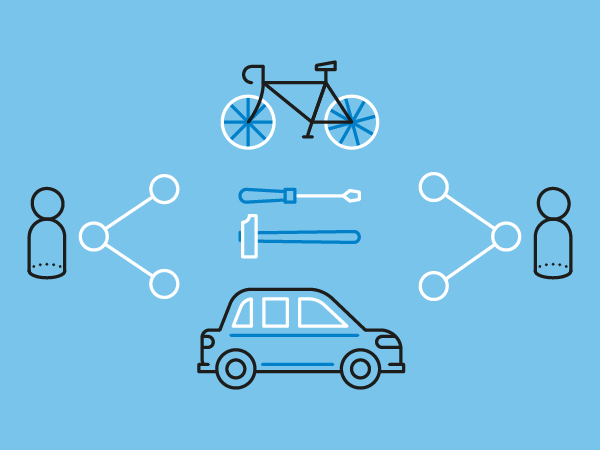Die digitale Transformation beschert uns eine Unmenge an Daten. Zudem stellt sie Techniken für einen möglichst sicheren Informationsaustausch zur Verfügung. Dieses Potenzial für einen effizienten Umgang mit Ressourcen gilt es allerdings zu gestalten, damit es tatsächlich der Umwelt zugutekommt.
Text: Lucienne Rey
Der Ursprung der weltumspannenden Datenautobahnen liegt bei Meyrin, einem kleinen Ort im Kanton Genf. Dort – genauer gesagt am CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung – entwickelte der Physiker Tim Berners-Lee im Jahr 1989 ein Verfahren, um Informationen über zahlreiche miteinander verbundene Computer auszutauschen. So schuf er die Voraussetzungen, um gewaltige Datenmengen überhaupt erst zu handhaben. Das CERN selbst erzeugt nämlich in seiner grössten Anlage, dem Grossen Hadronen-Speicherring LHC, jährlich 50 Millionen Gigabyte an auszuwertenden Daten. Auf DVD gebrannt, wären davon 100 Millionen nötig, was einen Stapel von etwa 12 Kilometern Höhe ergäbe. Diese Flut von Bits und Bytes lässt sich nur dank eines Verbunds von rund 170 über den Globus verteilten Computernetzwerken verarbeiten.
Welterkenntnis dank Big Data
Längst erhofft sich nicht mehr nur die Grundlagenforschung Erkenntnisse aus «Big Data» – so nennt die Fachwelt grosse, komplexe und wenig geordnete Datenbestände. Auf handfeste Anwendungen ausgerichtet ist etwa das europäische Forschungsprojekt «Data-Driven Bioeconomy» (kurz: DataBio). Mithilfe von Datensätzen aus verschiedensten Quellen will es die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei nachhaltiger gestalten.
Für die Schweiz an DataBio beteiligt ist auch Katarina Stanoevska-Slabeva vom Forschungsbereich Digital Communication an der Universität St. Gallen. «Die verwendeten Technologien sind äusserst komplex», erklärt sie. Für die Fischerei würden beispielsweise die zahlreichen von modernen Hochseeschiffen erhobenen Daten mit solchen aus anderen Quellen, etwa von Satelliten, verknüpft. «Angaben über Temperatur, Sauerstoffsättigung und Salzgehalt des Wassers sowie Informationen über verfügbare Nährstoffe fliessen in Modelle ein, die es gestatten, für eine Region die Wahrscheinlichkeit für den Aufenthalt bestimmter Fischschwärme zu berechnen», sagt die Professorin. Zum einen entfielen dadurch treibstoff- und damit CO2-intensive Suchfahrten der Fangflotten. Zum andern werde die Fischerei transparenter, sodass der Überfischung entgegengetreten werden könne. «Die Regulierung kann daher auf viel präziseren Daten aufbauen», bilanziert die Forscherin.
Die seit der Lancierung von DataBio im Jahr 2017 durchgeführten Pilotprojekte bestätigen, dass nicht nur die Fischerei effizienter wird, sondern auch die Landwirtschaft dank Big Data Wasser, Düngemittel und Pestizide einsparen könnte. Die gewaltigen Datensätze nützen auch der Forstwirtschaft: «Gerade in grossräumigen oder schwer zugänglichen Waldgebieten können Satellitendaten frühzeitig auf kranke Bestände hinweisen oder bei der Kontrolle gebietsfremder invasiver Arten dienen», ist Katarina Stanoevska-Slabeva überzeugt.
Text Digitalisierung - eine Übersicht
Die digitale Transformation soll es ermöglichen, eine bessere Ressourcen- und Energieeffizienz sowie eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft zu erreichen. In der Schweiz sind die Konsum- und Produktionsbereiche mit den grössten Auswirkungen auf die Umwelt die Ernährung, das Wohnen und die Mobilität. Welche Technologien und Konzepte der digitalen Transformation können helfen, speziell in diesen Bereichen unseren Umgang mit Ressourcen schonend zu gestalten? Und welches sind neben den Chancen die damit verbundenen Risiken?
Wolke mit Materialbedarf
Nicht nur die Forschung ist für den Umgang mit ihren Daten auf Computernetzwerke angewiesen. Auch Ämter und andere Organisationen mieten mittlerweile Speicherplatz bei externen Anbietern und lagern Daten aus – in die sogenannte Cloud. Allerdings führt das sprachliche Bild der «Datenwolke» in die Irre, ist doch die dafür erforderliche Infrastruktur alles andere als körperlos. So ermittelte eine Studie, dass allein in deutschen Rechenzentren mindestens 12 000 Tonnen Elektronik verbaut sind. Diese wiederum enthält knapp 2 Tonnen Gold, gut 7 Tonnen Silber und fast eine Tonne Palladium. Die Sensoren, die künftig im «Internet of Things» (IoT) für die Vernetzung von Alltagsgeräten erforderlich sein werden, dürften den Materialverbrauch zusätzlich befeuern.
Für Olivier Jacquat von der Sektion Innovation beim BAFU ist indes nicht nur die steigende Materialmenge bedenklich, sondern auch der Gehalt an seltenen Metallen, die in den Endgeräten – zum Beispiel in unseren Handys – stecken. «Da diese Rohstoffe nur in Kleinstmengen verbaut werden, ist ihr Recycling technisch anspruchsvoll», erklärt er. Um eine Rückgewinnung von raren Ressourcen voranzutreiben, führte das BAFU diverse Studien und Innovationsprojekte zur Rückgewinnung seltener Metalle durch. Ein Projekt ist ein Tool für KMU zur Evaluation der Abhängigkeit von diesen Ressourcen. Weil sich nämlich die Lagerstätten vieler dieser sogenannten Gewürzmetalle auf wenige Länder konzentrieren, besteht die Gefahr, dass sie dem Rest der Welt nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn die Ausfuhr unterbunden würde. Die Geräte, die bereits in Umlauf sind, werden somit selber zum Rohstofflager.
Energiefresser
Austausch und Verarbeitung von Daten brauchen zudem Elektrizität. In einem Aufsatz bezifferte Informatikprofessor Friedemann Mattern den Stromverbrauch für den Betrieb des Internets und die Herstellung der dazu erforderlichen Hardware für das Jahr 2012 auf 1230 Terawattstunden; dies entspricht 5 Prozent des globalen Stromverbrauchs. Zwar werden die Geräte immer kleiner und leistungsfähiger; doch der wachsende Appetit nach Daten führt dazu, dass der Energieverbrauch des Netzes rascher wächst als die Effizienz der Hardware und sich vom Betrieb der Endgeräte zu Datenübertragung und -verarbeitung verlagert. Fachleute schätzen, dass bis 2025 ein Fünftel des weltweiten Stromverbrauchs auf den Betrieb der Rechenzentren entfallen wird – mit den entsprechend schwerwiegenden Folgen für das Klima.
Eine weitere Erscheinung der digitalen Transformation wird oft in Zusammenhang mit dem zunehmenden Stromhunger in Verbindung gebracht: die Blockchain. Dabei handelt es sich um eine Art digitalen Vertrag, der verschlüsselt und dezentral auf einer Vielzahl von Computern abgelegt ist und es gestattet, Transaktionen direkt und ohne Vermittler durchzuführen. Zuweilen wird die Blockchain mit dem Kerbholz verglichen: Bis ins 20. Jahrhundert pflegten manchenorts Geschäftspartner ihre Verbindlichkeiten auf ein Holzscheit einzuritzen, das sie anschliessend entzweibrachen. Wieder zusammengefügt, wurde zweifelsfrei ersichtlich, ob die beiden Hälften zusammenpassten oder ob sie in der Zwischenzeit manipuliert worden waren.
Ebenso fälschungssicher ist die Blockchain. Ihr bekanntestes Einsatzgebiet sind digitale Währungen wie Bitcoin. Das aufwendige Verfahren bei der Überprüfung der Verschlüsselung benötigt allerdings viel Strom: Jährlich verbraucht die Cyberwährung weltweit doppelt so viel davon wie Dänemark. Doch die Blockchain kann auch dazu beitragen, Strom zu sparen. In einem New Yorker Quartier können Private seit 2016 untereinander mit Solarstrom handeln, den sie auf ihren Dächern erzeugt haben; die Vermittlung durch ein Energieversorgungsunternehmen entfällt. In Deutschland wiederum wurden Pilotversuche gestartet, um den von Elektromobilen getankten Strom automatisch mittels Blockchain abzurechnen. Denn diese enthält sämtliche Angaben über Produktion und Vermarktung eines Gutes und gewährleistet weitestgehende Rückverfolgbarkeit. Ob damit in erster Linie der Markt transparenter oder die Kundschaft gläsern wird, muss die Zukunft zeigen.
5G: Es besteht Forschungsbedarf
Der digitale Mobilfunk hat sich seit seiner Einführung in den 1990er-Jahren stetig weiterentwickelt, als nächster Ausbauschritt wird die 5. Generation (5G, New Radio) eingeführt. 5G soll neuartige Anwendungen (Internet of Things, automatisiertes Fahren usw.) ermöglichen und die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen. Über die Art und Weise, wie der weitere Ausbau der Mobilfunknetze vor sich gehen soll, ist in den letzten Jahren in der Politik und in der Bevölkerung eine intensive Diskussion entstanden, befürchtet werden insbesondere auch gesundheitliche Auswirkungen.
Die Wirkung von Mobilfunkstrahlung auf den Menschen hängt von deren Intensität und Frequenz ab. Die Vorschriften des Umweltschutzgesetzes (USG) und der Verordnung über den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung (NISV) gelten für die Strahlung insgesamt und unterscheiden nicht zwischen den verschiedenen Technologien von Mobilfunk (2G, 3G, 4G, 5G). Die NISV begrenzt die Intensität der Strahlung mit Grenzwerten, die sich nach der verwendeten Frequenz unterscheiden.
Die zurzeit laufende Einführung von 5G erfolgt in Frequenzbereichen, wie sie bereits jetzt für den Mobilfunk und für WLAN verwendet werden. Die 5G-Anlagen, die bereits in Betrieb sind, müssen wie alle anderen Anlagen die Grenzwerte der NISV einhalten. Längerfristig soll 5G auch in einem höheren Frequenzbereich zur Anwendung gelangen, man spricht hier auch von «Millimeterwellen». Bei der Einwirkung solcher Strahlung auf den Menschen bestehen aus wissenschaftlicher Sicht noch Unklarheiten und Forschungsbedarf. Ein Zeitplan, wann in der Schweiz Millimeterwellen zur Anwendung gelangen könnten, liegt noch nicht vor. Deren Verwendung für Mobilfunk müsste durch den Bundesrat vorgängig über die Anpassung des Nationalen Frequenzzuweisungsplans (NaFZ) genehmigt werden.
Im April 2019 hat der Bundesrat eine Änderung der NISV beschlossen, dies auch im Hinblick auf den Ausbau der 5G-Netze. Das BAFU ist neu für den Aufbau und Betrieb eines Monitorings zuständig, das Auskunft zur Belastung der Bevölkerung durch nicht ionisierende Strahlung in der Umwelt gibt. Das BAFU soll auch periodisch über den Stand der Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Strahlung auf Menschen und Umwelt informieren.
Im Herbst 2018 hat das UVEK eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des BAFU eingesetzt, um die Bedürfnisse und Risiken für die nähere und weitere Zukunft von Mobilfunk und Strahlenbelastung, insbesondere im Zusammenhang mit 5G, zu analysieren. Die Arbeitsgruppe wird nicht über die Einführung von 5G entscheiden, sondern mit ihrem Bericht Optionen im Hinblick auf den zukünftigen Ausbau der Mobilfunknetze aufzeigen. Sie wird ihren Bericht mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen im Laufe des Jahres 2019 vorlegen. Das UVEK wird den Bericht veröffentlichen und anschliessend über das weitere Vorgehen entscheiden.
Mehr Infos zum Thema «5G-Netze» gibt es im Web-Dossier:
BAFU-Daten für die Bevölkerung
Das BAFU unterhält zahlreiche Messnetze. Die damit gewonnenen Daten können von der Bevölkerung genutzt werden. So bilden die Hydrologiedaten die Grundlage für die Entwicklung von Apps (aare.guru, Aare Schwumm oder Riverapp). Im Register SwissPRTR kann nach Betrieben gesucht werden, deren jährlicher Schadstoffausstoss über einer international festgelegten Schwelle liegt (www.prtr.admin.ch). Mit dem «Metal Risk Check» können Unternehmen Ressourcenabhängigkeiten von «kritischen» Metallen grob beurteilen und Massnahmen einleiten (metal-risk-check.ch).
Weiterführende Informationen
Letzte Änderung 04.09.2019