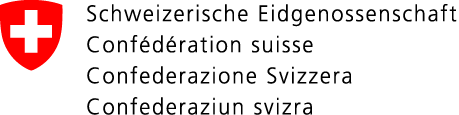Die Digitalisierung hat das Potenzial, den ökologischen Fussabdruck der Städte drastisch zu verkleinern. Doch der Weg dorthin ist noch weit.
Text: Christian Schmidt

© BAFU
Alexandre Bosshard ist ein guter Showmaster.
In einem Sitzungszimmer der Stadtverwaltung von Pully (VD) beamt er eine Karte an die Wand. Sie zeigt eine nachtschwarze Welt, nichts als Kontinente und Wasser. Dann, in Asien, ein roter Punkt. «Singapur» steht darunter. Bosshard lässt das Bild wirken, schweigt. Ein zweiter roter Punkt im arabischen Raum. «Dubai». Bosshard schweigt immer noch. Nun beginnt ein dritter Punkt zu leuchten. In Europa. In der Schweiz. «Pully». Pully auf einer Ebene mit Dubai und Singapur. Pully hat 18 000 Einwohner, die anderen Städte zählen mehrere Millionen. Was hat der Vorort von Lausanne in dieser Liga zu suchen? Alexandre Bosshard, Kulturingenieur mit Zweitausbildung in Psychologie, seit sechs Jahren Koordinator der Digitalisierungsprojekte von Pully, kurzer Bart, Brille, holt aus: «Die ITU hat uns als dritte Stadt weltweit mit dem Label ‹Smart Sustainable City› ausgezeichnet.» Die ITU, das ist die International Telecommunication Union, eine Unterorganisation der UNO. Als Bosshard zur Überreichung des Zertifikats im April 2018 nach Malaga reiste, sass er, der Verwaltungsangestellte, mit Ministern und anderen illustren Häuptern am gleichen Tisch.
Vielversprechendes Konzept
Pully liegt über den Ufern des Genfersees und unterscheidet sich an diesem Frühlingstag in nichts von anderen Städtchen. In einer Tiefgarage testen Kids ihre Skateboards; eine Frau ist am Handy; an der Rue de la Poste erhalten Bäume den Frühlingsschnitt. Von einer Smart City ist nichts zu spüren. Doch das, was in Pully entsteht, ist – zumindest theoretisch – eine der vielversprechendsten Erfindungen, seit Tim Berners-Lee die Welt mit dem Internet beglückte. Das Konzept hinter dem Stichwort «Smart Cities» hat das Potenzial, energiefressende Siedlungsräume in menschenfreundliche und nachhaltige Lebensräume zu verwandeln. Bosshard erklärt: «Die ITU misst anhand von 87 Kriterien die Digitalisierung von Städten, wobei sie besonderes Gewicht auf den Aspekt der Nachhaltigkeit legt.» Zu diesen Kriterien zähle etwa der Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch der Stadt, eine nachhaltige Bauweise öffentlicher Gebäude, die Länge der Radwege und die Anzahl Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner. Weltweit rund 50 Länder hätten inzwischen mit der Erfassung der entsprechenden Indikatoren begonnen. Und Pully mischt ganz vorne mit. Weshalb, erklärt Alexandre Bosshard in einem der benachbarten Büros. Hier kann er an einem der Bildschirme sein wichtigstes Projekt in Sachen Smart City demonstrieren. Es nennt sich «Observatoire de la mobilité». Das Projekt entstand 2015aus einer Kooperation zwischen Pully, Swisscom und der Eidgenössischen technischen Hochschule in Lausanne (École polytechnique fédérale, EPFL). Eine gemeinsam entwickelte Software hilft, die Verkehrsflüsse in Pully zu analysieren – auf Basis der Datenspuren, die Mobiltelefone auf den Antennen hinterlassen. Dank ihnen lässt sich nachvollziehen, woher die Menschen nach Pully kommen, wie sie sich bewegen, wie lange sie im Ort verbleiben und wohin sie danach gehen. Die Spuren auf dem Monitor erinnern an Flugzeugbewegungen auf einem Radarschirm. Für Bosshard ist das Observatorium ein «wertvolles und intelligentes Werkzeug», um die gegenwärtige Situation zu verstehen und die Zukunft zu gestalten. «Früher erhielten wir die Ergebnisse unserer Verkehrszählungen alle fünf Jahre, heute jede Stunde.» Nun lässt sich laufend überprüfen, wo und wann sich der Verkehr in Pully staut, ob eine neue Buslinie ihre Wirkung tut und die Strassen vom Privatverkehr entlastet werden. Und Bosshard weiss nun auch, dass der grösste Teil der erfassten Menschen nur auf der Durchreise ist und gar nicht in Pully bleibt. Das möchte er ändern: «Wir werden das Zentrum verkehrsberuhigen und fussgängerfreundlicher gestalten», was weniger Lärm und weniger Abgase, dafür eine höhere Lebensqualität bedeute.
Häppchenkultur statt Gesamtsicht
Die Verwandlung einer Stadt in eine «Smart City» ist zum Trend geworden, bei dem alle mitmachen wollen, oder anders gesagt: bei dem es sich niemand leisten kann hintenanzustehen. Mit einem Engagement für die Nachhaltigkeit und den damit verbundenen Verheissungen lässt sich im Konkurrenzkampf der Städte um weitere Einwohner – und damit Steuerzahlende – punkten. Winterthur (ZH) etwa steuert die Beleuchtung der städtischen Velowege so, dass sie nur bei Bedarf angeht. Zürich lanciert im kommenden Jahr ein Rufbus-System für Passagiere, die zu Randzeiten abseits der üblichen Busrouten unterwegs sind. Um bei der Einführung des neuen 5G-Netzwerks keine Probleme mit zu hoher Strahlung zu bekommen, setzt St. Gallen auf eine Vielzahl kleiner Antennen; ebenso testet die Stadt zwecks Reduktion des Suchverkehrs Parksensoren. Diese stellen fest, wo es freie Plätze gibt, und kommunizieren den Status mittels App. Der Genfer Stadtteil Carouge hat entlang der Strassen gut 600 Sensoren installiert, um den Lärm zu messen und anschliessend Gegenmassnahmen zu treffen. Wil (SG) hat einen speziellen Online-Shop eröffnet, in dem die Bevölkerung zu einem günstigen Preis besonders energieeffiziente Geräte kaufen kann. Und auch der Bund mischt bei der digitalen Nachhaltigkeit mit: Bis ins Jahr 2027 werden in jedem Haushalt intelligente Strommesssysteme zur Pflicht. Diese machen es unter anderem möglich, bei Abwesenheit alle Geräte per Handy auszuschalten. Bloss: Wie gut ist diese Entwicklung für die Umwelt?
Matthias Finger, Professor an der EPFL und spezialisiert auf Infrastrukturen, spricht von einer «Häppchenkultur». Alle diese Ideen würden von den jeweiligen Verwaltungsabteilungen einzeln lanciert, «meistens ohne Koordination mit anderen Abteilungen», und würden als Grund dafür genommen, die ganze Stadt danach als «smart» zu bezeichnen. Überhaupt sei das ganze Thema immer noch ein «Hype», bei dem nicht die Verwaltungen die treibenden Kräfte seien, sondern die Verkäufer der entsprechenden Soft- und Hardware. Deshalb gebe es auch keine Standards, «die einen allgemein gültigen, verbindlichen Ansatz für das Thema ‹intelligente Städte› beinhalten». Tatsächlich überzeugen nicht alle der als nachhaltig bezeichneten Projekte. Parksensoren beispielsweise vermögen zwar tatsächlich den Suchverkehr zu reduzieren, aber mit dem Hinweis auf freie Plätze locken sie Mehrverkehr ins Stadtzentrum und torpedieren damit weit bessere Lösungen wie umsteigen auf den ÖV oder Park and Ride.
Smart City war zuerst eine Marketing-Idee
Andere Vorschläge kollidieren mit dem Thema Datenschutz. In Wil erlauben es die Einkäufe im Online-Shop der Stadtverwaltung, zu beobachten, wer sich in der Gemeinde für energiesparende Geräte interessiert oder eben nicht. Das Gleiche tun die vom Bund vorgeschriebenen smarten Strommesser; sie melden in Echtzeit den jeweiligen Stromversorgern, wer wie viel Energie konsumiert und somit positiv oder negativ auffällt. Alexandre Bosshard kennt die Kritik. Und versteht sie: Das Stichwort ‹Smart City› sei nicht vor dem Hintergrund des Umweltschutzes entstanden, «sondern als Marketing-Idee der grossen Unternehmen im Bereich Informationstechnik». Tatsächlich eröffnet sich ihnen hier ein gigantischer Geschäftszweig. Der Ruf nach smarten Städten ist so laut, dass das amerikanische Marktforschungsinstitut Persistence der Branche einen gewaltigen Mehrumsatz prognostiziert. Bereits 2026 soll ihr Umsatz 3500 Milliarden Franken betragen – eine Summe, die das jährliche Haushaltsbudget der Schweiz um rund das 50-Fache übersteigt. Pully macht bei diesem Eldorado allerdings nicht mit und geht eigene Wege. Die Stadt setzt auf OpenSource-Programme, die zusammen mit anderen Schweizer Städten sowie Programmierern aus verschiedenen Ländern gezielt entwickelt werden. Zudem, sagt Bosshard, gehöre Pully nicht zu den Städten, die sich mit einigen wenigen Ideen gleich den – ungeschützten – Titel «Smart City» verleihen. «Wir haben insgesamt 20 Projekte zum Thema, die neben der ökologischen auch eine ökonomische und soziale Nachhaltigkeit anstreben.» Dazu gehören etwa ein zentrales Informationssystem für die Bevölkerung, eine Internet-Kommunikationsplattform für Personen über 65, ein Online-Shop für lokale Produkte sowie diverse Projekte zur Effizienzverbesserung der Verwaltung. Und beim «Observatoire de la mobilité» sehe er keine Probleme bezüglich Datenschutz: «Der Bildschirm zeigt nur Statistiken, die auf anonymisierten Daten basieren. Wir sehen weder in die Smartphones hinein noch wissen wir, wem sie gehören.»
Vorbild in Südkorea
Trotz einigen Fragezeichen hat das Thema Smart City insgesamt ein grosses Potenzial. Einen Schritt in diese Richtung zeigt das Beispiel der koreanischen Modellstadt Songdo mit seinen rund 100 000 Einwohnern. Die Stadt ist autofrei, und jeder Haushalt ist an eine Zentrale Aufbereitungs- und Wiederverwertungsanlage angeschlossen. So ist der durchschnittliche Energieverbrauch pro Person um 40 Prozent tiefer als in anderen Städten Südkoreas. Dieses Potenzial der Smart Cities erkennt auch EPFL-Professor Matthias Finger. Gerade hinsichtlich Effizienz und Nachhaltigkeit sei es «gross». Doch er relativiert: «Viele der technologisch möglichen Effizienzsteigerungen lassen sich nur verwirklichen, wenn Daten verfügbar gemacht und ausgetauscht sowie Standards definiert und durchgesetzt werden.» Dies alles erfordere eine starke Regulierung und den entsprechenden politischen Willen, insbesondere betreffend Datenschutz und Datensicherheit. «Der Weg dorthin ist noch weit.»
Innovationen gezielt vorantreiben
«die umwelt» befragt Markus Wüest, Chef der Sektion Umweltbeobachtung beim BAFU und BAFU-Vertreter des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) für den Bereich «Smart Cities».

Was tut der Bund in Sachen Smart Cities?
Markus Wüest: Der Bundesrat hat im Januar 2019 ein Zielbild gutgeheissen. Es dient als Leitlinie beim Aufbau der digitalen Infrastrukturen und bei der digitalen Transformation der Bundesverwaltung. Zudem erarbeitet das UVEK zurzeit einen Massnahmenplan zur Unterstützung der Städte, Gemeinden und Kantone bei der Entwicklung von Smart Cities, Smart Villages und Smart Regions.
Existieren innerhalb der Verwaltung bereits smarte Bereiche?
Ja. Die Bundesverwaltung hat die Work-Smart-Initiative unterzeichnet, die flexible Arbeitsformen fördert und damit zur CO2-Einsparung und zur Verkehrsentlastung beiträgt. Zudem läuft das Projekt «Ressourcen- und Umweltmanagement der Bundesverwaltung», kurz RUMBA. Hauptziele sind die kontinuierliche Verminderung von betrieblichen und produktbezogenen Umweltbelastungen sowie die Koordination der Umweltaktivitäten der zivilen Bundesverwaltung. Darüber hinaus hat der Bund das Nationale Forschungsprogramm «Digitale Transformation» (NFP 77) lanciert.
Das heisst?
Hauptziel des Programms ist es, Wissen über die Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Gesellschaft und die Wirtschaft zu erarbeiten. Im Zentrum stehen dabei Themen wie «Bildung, Lernen und digitaler Wandel» oder «Ethik, Vertrauenswürdigkeit und Gouvernanz». Das Programm dauert fünf Jahre.
Doch sind Smart Cities überhaupt eine gute Idee? Bei der Verarbeitung der Datenflut erzeugen die weltweiten Rechenzentren bereits heute zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Das soll sich verdreifachen.
Ja, Smart Cities sind eine gute Idee – wenn wir ihre Möglichkeiten richtig nutzen. Das Ziel, die Nettoemissionen von CO2 bis spätestens 2050 weltweit auf null zu senken und so die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, dürfen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren. Damit das gelingt, müssen wir die Innovationen gezielt vorantreiben und als Gesellschaft die Rahmenbedingungen richtig setzen.
Letzte Änderung 04.09.2019