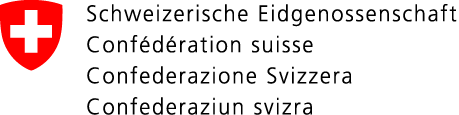Ausgehend von standardisierten Komponenten versucht die Synthetische Biologie, im Labor biologische Systeme nachzubauen, zu verändern oder neu zu entwerfen. Über die Potenziale und die möglichen Risiken der jungen Fachrichtung hat sich «die umwelt» mit der Biologin Yolanda Schaerli und dem Ethiker Gérald Hess unterhalten.
Interview: Lucienne Rey

Yolanda Schaerli ist als Assistenzprofessorin an der Universität Lausanne tätig. Nach einem Studium der Biochemie und Molekularbiologie an der ETH Zürich arbeitete sie zuvor im Rahmen mehrjähriger Forschungsaufenthalte an der Universität Cambridge (UK), am Centre for Genomic Regulation in Barcelona und an der Universität Zürich.
Von 2003 bis 2010 befasste sich der Philosoph Gérald Hess als wissenschaftlicher Mitarbeiter des BAFU mit ethischen Fragen, die insbesondere die Biotechnologie aufwirft. Heute unterrichtet er als Lehr- und Forschungsbeauftragter an der Fakultät für Geowissenschaften und Umwelt der Universität Lausanne das Fach Umweltethik.
© Flurin Bertschinger | Ex-Press | BAFU
Woran arbeiten Sie zurzeit, Frau Schaerli?
Yolanda Schaerli: Meine Gruppe interessiert sich für Genregulationsnetzwerke. Wir möchten mehr über die Evolution und die Mechanismen dieser Netzwerke lernen. Dabei arbeiten wir mit Escherichia coli-Bakterien und folgen dem Bottom-up-Ansatz der Synthetischen Biologie (dieser zielt darauf ab, biologische Systeme von Grund auf neu zu erzeugen, die Red.). Leitend ist die Idee: Wenn man etwas bauen kann, dann kann man es besser verstehen. Im Blickpunkt unserer Forschung stehen Netzwerke, die räumliche Muster erzeugen – wie beispielsweise auf den Flügeln von Schmetterlingen. Auch in der Embryonalentwicklung sind räumliche Muster wichtig.
Was sagt der Ethiker, wenn er hört, dass man etwas nachbaut, um es besser zu verstehen?
Gérald Hess: Zuerst einmal bezweifle ich, dass die Synthetische Biologie gegenüber der Gentechnik etwas grundsätzlich Neues bringt. Beides fügt sich in die westliche Denktradition ein, wonach die Natur so modifiziert werden darf, dass sie für den Menschen nützlich ist und seinen Zielen entspricht. Das ist eine Vorstellung, die erst mit der Wissenschaft des 17. Jahrhunderts ihren Durchbruch hatte. In der griechischen Antike war das noch anders, da wurde Wissen um seiner selbst geschätzt. Heute treibt man selbst die Grundlagenforschung in der Absicht voran, sie für bestimmte praktische Ziele anzuwenden.
Schaerli: Das Feld in der Synthetischen Biologie ist recht weit. Es gibt Gruppen, die deklarieren, für welche Anwendungen ihre Forschung genutzt werden könnte. Andere sind erst einmal auf reinen Wissenszuwachs aus. Die Synthetische Biologie erweitert die bisherige Gentechnik aber durchaus um neue Elemente. Zum Beispiel legt sie viel Wert auf Standardisierung, Modularität und Abstraktion. Ausserdem forscht sie eher an Netzwerken und Stoffwechselpfaden und weniger an einzelnen Genen.
Hess: Gemeinsam ist aber beiden Ansätzen, dass sie das Lebendige reduktionistisch betrachten und instrumentalisieren, sodass es sich für bestimmte Zielsetzungen transformieren lässt.
Schaerli: Das ist allerdings nichts Neues, sondern trifft beispielsweise auch auf die konventionelle Pflanzenzüchtung und Tierzucht zu. Wir haben höchstens die Präzision der Eingriffe verbessert.
Was genau ist für Sie «Leben», wodurch ist es gekennzeichnet?
Schaerli: Selbst Biologen und Biologinnen tun sich schwer mit dieser Frage. Es gibt eine Reihe von Merkmalen, etwa dass Lebewesen in Zellen organisiert sind, über einen Stoffwechsel verfügen, wachsen und sich verändern. Ausserdem reagieren sie auf Reize und pflanzen sich fort. Bestimmte Grenzfälle wie Viren erfüllen aber nicht alle genannten Kriterien.
Hess: Aus philosophischer Perspektive unterscheiden wir zwei Sichtweisen. Die eine geht von Eigenschaften aus, die bestimmte Funktionen erfüllen. Sie betrachtet die Äusserlichkeiten des Lebendigen, das sie somit objektiviert und manipulierbar macht. Im Unterschied dazu akzeptiert die ganzheitlichere Auffassung zwar eine Reihe äusserlicher Merkmale. Sie setzt aber zugleich auch voraus, dass die Forschenden selbst Lebewesen sind und nur als solche das Leben überhaupt verstehen können. Diese Position geht davon aus, dass die Wissenschaft nicht alles Lebendige objektivieren und erklären kann.
Wenn die Synthetische Biologie Organismen zusammenbaut, die es so noch nicht gibt, vermag sie diese zu kontrollieren und die Folgen ihrer Experimente abzuschätzen?
Schaerli: Wir sind noch nicht so weit, tatsächlich neue Organismen zu konstruieren. Aber uns leitet die Idee, dass durch das Prinzip des Engineerings die Eingriffe auch in der Biologie planbar werden. Wenn wir eine Brücke bauen, zeigen uns die Pläne, was am Ende entstehen wird. Die Biologie ist allerdings sehr komplex, was die Vorhersehbarkeit erschwert. Zugleich macht es diese Arbeit spannend, was auch der Grund ist, wieso sie mich fasziniert.
Können Sie verstehen, dass es Menschen gibt, die vor Ihrer Arbeit Angst haben – weil Sie möglicherweise etwas bauen, was Ihnen wie beim Zauberlehrling über den Kopf wachsen könnte?
Schaerli: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen, und daher ist es auch wichtig, zu erklären, was wir machen und welche Sicherheitsmassnahmen wir anwenden. Wir müssen in der Gesellschaft Interesse und Verständnis für unsere Forschung wecken. Denn schliesslich trägt die Synthetische Biologie dazu bei, heute vielfach praktizierte Anwendungen zu verbessern. Und sie ermöglicht neue Anwendungen, etwa in der Synthese von Chemikalien oder bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten.
Hess: Um zu beurteilen, ob es sich bei einer Technologie um eine Verbesserung handelt, muss in erster Linie die Zielsetzung betrachtet werden. Es gibt durchaus lobenswerte Ziele, etwa wenn gentechnisch modifizierte Organismen zur Herstellung von Medikamenten dienen.
Mit neuen Technologien wie CRISPR/Cas und Gene Drive (siehe Box und Grafik auf S. 9) ist es im Prinzip möglich, beispielsweise ganze Populationen von Mücken, die die Malaria übertragen, auszumerzen. Sollten wir diese Möglichkeiten nutzen?
Hess: Auch hier gilt: Zunächst muss das Ziel moralisch legitim sein, was bei der Bekämpfung einer schweren Krankheit sicher der Fall ist. Sodann gilt es zu klären, welche Risiken für Mensch und Umwelt bestehen und ob diese handhabbar sind. Wird eine solche Technik in ein komplexes Ökosystem eingeführt, lassen sich die Nebenfolgen allerdings kaum abschätzen. An erster Stelle muss daher das Vorsorgeprinzip stehen, das vor jeglicher Anwendung einer neuen Technologie versucht, die noch ungewissen Folgen abzuklären, um die Risiken so gut wie möglich identifizieren und einschätzen zu können.
Es wird auch darüber diskutiert, mithilfe dieser Techniken bestimmte Tierpopulationen, die von einer existenziellen Erkrankung bedroht sind, gegen diese zu immunisieren. Was halten Sie von solchen Überlegungen?
Schaerli: Bei solchen Eingriffen ins Ökosystem sollte man meiner Meinung nach sehr vorsichtig sein; die eingefügten Veränderungen könnten unter Umständen auf andere Arten überspringen. Jedenfalls wäre jede Anwendung einzeln zu überprüfen, und es käme auch auf die Alternativen an.
Hess: Es lässt sich nicht a priori entscheiden, ob eine Technologie genutzt werden oder auf sie verzichtet werden soll. Es gälte natürlich, die Risiken zu klären und die Absichten zu hinterfragen. Aber wenn mit einer Technik eine bedrohte Art gerettet werden kann und es sicher ist, dass dadurch keine anderen Risiken entstehen, sehe ich wenig Gründe, die gegen ihren Einsatz sprechen.
In der Schweiz sind einige Verfahren zur Erzeugung von Organismen mit neuen Merkmalen wie etwa in der Pflanzenzüchtung unterschiedlich geregelt. Wenn für die ethische Beurteilung die Zielsetzung den Ausschlag gibt, wäre da nicht das Endprodukt in den Blickpunkt zu stellen – unabhängig davon, ob es beispielsweise mit Strahlung oder Gentechnik (siehe Grafik Artikel «Grosse Diskussionen um einen kleinen Schnitt») hergestellt wird?
Hess: Eigentlich schon. Es gibt halt gewisse Inkohärenzen. Bestrahlung und gentechnischer Eingriff können zwar die gleiche Wirkung entfalten, doch man hält die Strahlung für sicherer. Das könnte aber durchaus ein Irrtum sein. Jede Technik sollte achtsam eingesetzt werden. Hier kommt das Vorsorgeprinzip zum Tragen, das ein schrittweises Vorgehen fordert: Neue Entwicklungen werden zuerst im Labor getestet, dann in geschlossenen Systemen und dann auf abgeschirmten Freilandflächen.
Schaerli: Da bin ich mit Ihnen einverstanden. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es erlaubt ist, solche Versuche überhaupt durchzuführen. Sonst ist es nicht möglich, die erforderlichen Kenntnisse zu erwerben.
In der Bundesverfassung ist die Rede von der «Würde der Kreatur». Haben aus Ihrer Sicht auch Bakterien eine Würde, die verletzt werden kann?
Schaerli: Die Würde ist ein menschliches Konzept, und was uns nähersteht, gewichten wir mehr. Es fällt uns schwerer, Tiere zu töten als Pflanzen. Bakterien sind uns noch einmal ferner. Ich persönlich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich im Labor meine Experimente mit Bakterien durchführe. Auf sie das Konzept der Würde anzuwenden, bereitet mir Mühe. Aber wir sollten sie sicher nicht gedankenlos ausführen.
Hess: In der französischen Übersetzung des Verfassungsartikels 120 wird für «Würde der Kreatur» nicht der Ausdruck «dignité» verwendet, sondern «intégrité des organismes vivants». Dieser Ausdruck lässt sich besser als der Begriff der Würde auf das gesamte Lebendige anwenden, indem allen lebenden Organismen ein moralischer Wert zukommt. Für Bakterien aber wurden keine Gesetze verabschiedet, weil ihr moralischer Status zu schwach ist. Generell gibt es nicht die eine ethische Position: Je nachdem, ob etwa die Denkfähigkeit oder aber die Leidensfähigkeit oder schlicht die Lebenskraft eines Organismus als Kriterium zählt, fällt die moralische Bewertung anders aus. Mit dem Begriff der Würde der Kreatur wollte der Gesetzgeber darauf hinweisen, dass es gewissen Teilen der Natur Rechnung zu tragen gilt.
Im Zusammenhang mit der Synthetischen Biologie werden gelegentlich Befürchtungen laut, in der «Do-it-yourself-Biologie» könnten in einer Garage ein Labor eingerichtet und die biologischen Komponenten über Internet bestellt werden. Wie schätzen Sie die Gefahr von Missbrauch ein?
Schaerli: Die Hürden sind hoch, es braucht dazu eine gute Ausbildung. Die Biohacking-Labors befolgen meistens einen ethischen Kodex. Und natürlich müssen sie die gleichen Sicherheitsregeln einhalten wie die Labors von Hochschulen oder Betrieben. Die Biohacker haben auch eine sehr positive Wirkung, indem sie Leute informieren und für die Biologie begeistern (vgl. Artikel «Gentech-Experimente in der Garage», Anm. d. Red.). Gerade in der Synthetischen Biologie pflegt man eine starke Kultur des Teilens und gewährt den Kollegen Zugriff auf die Erkenntnisse.
Kann die Ethik etwas gegen die Demokratisierung der Wissenschaft einwenden?
Hess: Nein, überhaupt nicht. Die Öffentlichkeit muss über technische Entwicklungen auf dem Laufenden sein, und es sollte einen Rahmen geben, wo sie sich unabhängig von wirtschaftlichem Druck informieren kann. Die Schwierigkeit liegt allerdings darin, dass eine Technik meistens bereits existiert, bevor man mit der Bevölkerung darüber zu diskutieren beginnt.
Synthetische Biologie – von der Manipulation zur Kreation
Die Synthetische Biologie ist ein Fachgebiet im Grenzbereich von Molekularbiologie, organischer Chemie, Ingenieurwissenschaften, Nanobiotechnologie und Informationstechnik. Sie wird von einigen ihrer Vertreter und Vertreterinnen als die neueste Entwicklung der modernen Biologie bezeichnet. Unter den Begriff «Synbio» fallen verschiedene Ansätze. Gemeinsam ist ihnen das Ziel, neuartige Organismen oder biologische Komponenten herzustellen. Sie setzen aber auf unterschiedlichen Ebenen an und weichen in ihren Methoden voneinander ab.
Bio-Engineering:
Ähnlich wie bei einem Computer sollen im Bioengineering-Ansatz die einzelnen biologischen Bauteile (genetische Standard-Elemente) nach einer hierarchischen Struktur zusammengebaut werden. Bevor die Arbeit im Labor beginnt, erstellen die Forscher am Computer detaillierte Modelle von Regulationsmechanismen oder Stoffwechselwegen.
Synthetische Genomik:
In der synthetischen Genomik geht es darum, ein gesamtes Erbgut künstlich im Labor herzustellen. Mithilfe chemischer und molekularbiologischer Methoden werden die einzelnen Bausteine der DNA (die Nukleotide) in der gewünschten Reihenfolge aneinandergehängt. Kürzere DNA-Abschnitte, wie etwa ein einzelnes Gen, können bereits kommerziell bestellt werden. 2010 gelang es einer Forschergruppe um den amerikanischen Biochemiker Craig Venter, ein Bakterium mit einem komplett synthetisch erzeugten Erbgut herzustellen. Das Erbgut wurde nach einem natürlichen Vorbild produziert.
Xenobiologie:
Ziel dieser Forschungsrichtung ist es, Organismen mit einem neuen – in der Natur nicht bekannten (xeno bedeutet fremd) – genetischen System zu entwickeln. Manche Forscher versuchen, neue Formen von Nukleinsäuren («xeno nucleic acid», XNA) als Alternativen zu RNA (Ribonukleinsäure) und DNA (Desoxyribonukleinsäure) zu entwickeln. Andere bleiben bei den herkömmlichen Nukleinsäuren, wollen aber einen neuen genetischen Code entwerfen.
Protozellen:
Forschende, die diesen Ansatz verfolgen, wollen aus Molekülen lebende Zellen herstellen. Als Vorstufen produzieren sie sogenannte Protozellen, das heisst kleine Bläschen mit einer Fetthülle, in denen einzelne biochemische Reaktionen ablaufen. Bisher ist man aber noch weit davon entfernt, Zellen produzieren zu können, die sich als «lebend» bezeichnen liessen.
Quelle: naturwissenschaften.ch
Weiterführende Informationen
Letzte Änderung 29.05.2019