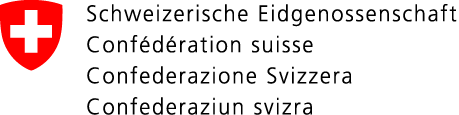Es gibt sie: die Initiativen in Richtung eines nachhaltigeren Lebens, die klein anfangen, aber manchmal grossen Einfluss bekommen. Stephanie Moser erforscht an der Universität Bern solche Nachhaltigkeits-Initiativen und ist beeindruckt von deren Vielfalt und Dynamik. Sie weist aber auch darauf hin, dass diese gerade in der Schweiz noch mehr Unterstützung benötigen.
Interview: Peter Bader

© Marion Nitsch/Lunax
Stephanie Moser, Sie untersuchen Initiativen, die ein nachhaltigeres Leben und Wirtschaften zum Ziel haben. Gleichzeitig denken aber viele Menschen, dass privates Engagement am grossen Ganzen nichts ändert. Frustriert Sie das?
Stephanie Moser: Nein. Ich verstehe die Frustration, wenn man sich persönlich bemüht und feststellt, dass auf einer übergeordneten Ebene zu wenig passiert. Trotzdem sind die kleinen Initiativen wichtig, weil daraus etwas Grösseres entstehen kann. Deshalb setze ich mich als Wissenschaftlerin für Rahmenbedingungen ein, die viele kleine Initiativen ermöglichen und es den Menschen leichter machen, ökologischer zu leben.
Welche Arten von Initiativen begegnen Ihnen in Ihrer Forschung vor allem?
Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen, die sich in der Schweiz und international mit grosser Dynamik entwickeln. Beispielsweise Unverpackt-Läden, Repair-Cafés, Solarbau-Initiativen oder Tausch- und Leihbörsen. Sie alle entstehen aus freiwilligem Engagement einzelner Gruppen und testen neue Formen des Wirtschaftens aus. Dabei steht nicht der Profit im Vordergrund, sondern die gesellschaftliche Verantwortung. Grundsätzlich geht es darum, dass ökologische, ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen möglichst einfach an Kundinnen und Kunden gelangen. Wichtig ist den Initiantinnen und Initianten auch, dass sich ihre Idee weiterverbreitet und von anderen übernommen wird. Vielversprechend ist aus meiner Sicht vor allem die grosse Vielfalt an Initiativen.
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Ein spannendes Projekt gibt es in Schweden: Im Einkaufszentrum Retuna werden ausschliesslich Produkte angeboten, die aus dem angegliederten Entsorgungshof stammen und nach einem Recycling oder einem Upcycling verkauft werden. Beim Upcycling werden aus Abfallstoffen neuwertige Produkte kreiert.
Worum es geht
Die wichtigsten regionalen Initiativen zur Verminderung von Umweltbelastungen finden sich in folgenden Bereichen:

1. Re-/Upcycling
Hier werden scheinbare Abfallprodukte verwertet und daraus neue Produkte hergestellt. Zum Beispiel Möbel aus Paletten oder Konservendosen, Haargummis aus Strumpfhosen, Trinkbecher aus Orangenschalen oder Bio-Plastik aus Fischabfällen – die Möglichkeiten sind endlos.

2. Nature-based solutions
Sie nutzen die Natur und deren klimaschützende ökologische Prozesse, um nachhaltigere Städte zu schaffen, etwa mit Dachgärten oder begrünten Fassaden. Beim Konzept der Schwammstädte werden zudem die Böden und Wasserkreisläufe miteinbezogen, um das Klima von Städten zu verbessern und der Klimaerwärmung entgegenzuwirken.

3. Ecodesign
Dabei macht man sich bereits beim Design eines Produkts Gedanken über dessen gesamten Lebenszyklus inklusive Reparierfähigkeit und Entsorgung und zielt auf eine möglichst lange Lebensdauer.

4. Prosuming
Hier sind Produzentinnen ihre eigenen Kunden. Etwa bei Energiegenossenschaften, die den Selbstbau von Solaranlagen unterstützen und die produzierte Energie gemeinschaftlich bewirtschaften. Oder bei solidarischen Landwirtschaftsprojekten, die saisonale und biologische Nahrungsmittel in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Kundinnen und Kunden produzieren und häufig gleichzeitig Habitate für Nützlinge einrichten.

5. Sharing
Teilen oder leihen: Der Verleih und das Sharing von Autos, Velos oder Lastenvelos fördert eine nachhaltige Mobilität und den ressourcenschonenden Langsamverkehr. Zudem werden durch Tauschen und Käufe aus zweiter Hand (etwa an Tauschbörsen) Gegenstände länger genutzt (etwa Kleider oder Ski).

6. Repair
Repair-Cafés oder offene Werkstätten verlängern die Nutzungsdauer von Alltagsgegenständen (beispielsweise Kleider, Möbel und elektronische Geräte), indem sie Nutzenden helfen, diese zu reparieren oder in anderer Form wiederzuverwenden.
Lohnt sich das?
Ja, soviel ich weiss schon. Natürlich ist es unabdingbar, dass solche Initiativen wirtschaftlich überleben. Allerdings stellt sich uns als Wissenschaftlerinnen die Frage, ob sie nicht einen gesellschaftlichen Beitrag wie der Sport oder die Kultur leisten und uns deshalb etwas wert sein sollten.
Sie sollten staatliche Förderung erhalten?
Das wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt auch andere entscheidende Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen. Zum Beispiel wird derzeit in der Schweiz diskutiert, ob es für solche Initiativen eine neue Rechtsform bräuchte, die auf Gemeinnützigkeit ausgerichtet ist. Es könnte eine Mischform sein zwischen den Rechtsformen für profitorientierte Unternehmen und einem Verein, der zwar steuerlich entlastet werden kann, aber dann Auflagen bezüglich Wirtschaftlichkeit hat.
Was müsste sich sonst noch ändern?
Grundsätzlich unterscheiden sich solche Initiativen nicht von Innovationen in anderen Bereichen: In der Aufbau- und Experimentierphase sind sie noch nicht wettbewerbsfähig. Deshalb bräuchte es Massnahmen wie in der klassischen Wirtschaftsförderung, zum Beispiel Mietvergünstigungen oder mehr öffentliche Plattformen, auf denen sie sich präsentieren oder austauschen können. So funktioniert im Raum Genf die Wirtschaftskammer Après: Sie fördert ökologische und sozialverträgliche Initiativen, die einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Solche Beispiele müsste es in der Schweiz noch mehr geben.
Dennoch: Die Umwelt- und Klimaprobleme haben wir nicht erst seit gestern, und gesamthaft ändert sich erschreckend wenig. Warum sind wir als Gesellschaft nicht schon weiter?
Es verändert sich schon etwas. Beispielsweise standen wir im Bewusstsein und in der politischen Debatte zum Klimawandel vor fünf Jahren noch an einem ganz anderen Ort. Aber die aktuelle Energiekrise führt uns halt auch sehr eindrücklich vor Augen, wie stark die Abhängigkeit der Gesellschaft und der Wirtschaft von fossilen Energieträgern ist, und wie komplex die verschiedenen Abhängigkeiten sind. Für Veränderungen in komplexen Systemen gibt es leider keinen einfachen Masterplan.
Werden diese Initiativen also eine wichtige Rolle spielen im Kampf gegen den Klimawandel?
Das ist schwer zu sagen und lässt sich auch nicht wissenschaftlich belegen. Aber dass zum Beispiel die Grossverteiler Coop und Migros inzwischen auch unverpackte Waren anbieten, daran haben die Nachhaltigkeits-Initiativen sicher einen wichtigen Anteil. Wenn sie bei grösseren Anbietern, in Produktionsbetrieben oder in den Köpfen der Menschen etwas verändern, ist schon viel erreicht. Die Nutzung der Sonnenenergie hat einst auch in Nischen begonnen.
Fazit
Es gibt viele unterschiedliche Initiativen von Privaten oder Unternehmen, die sich für ein nachhaltigeres Leben und Wirtschaften einsetzen – etwa Unverpackt-Läden, Repair-Cafés, Solarbau-Initiativen oder Tausch- und Leihbörsen. Sie fangen meist klein an, können aber durchaus über sich hinauswirken und Veränderungen bei grossen Unternehmen anstossen.
Weiterführende Informationen
Letzte Änderung 21.12.2022