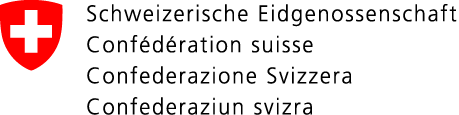Peter Messerli, Professor für nachhaltige Entwicklung an der Universität Bern, berät zusammen mit anderen Wissenschaftlern die Staatschefs bei der Umsetzung der Agenda 2030. Ein Gespräch über Erfolg versprechende Lösungsansätze, einen ressourcenschonenden Lebensstil und das Versagen der Politik.
Interview: Peter Bader

© Ephraim Bieri | Ex-Press | BAFU
Herr Messerli, Sie sind seit knapp drei Jahren Co-Leiter eines unabhängigen wissenschaftlichen Beirats, der Grundlagen zur Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bereitstellt. Welches war bisher die eindrücklichste Begegnung?
Peter Messerli: Es gab viele. Zum Beispiel mit all den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus vielen verschiedenen Disziplinen. Da mussten wir uns zuerst finden, die Verbindungen zwischen den einzelnen Disziplinen herstellen. Denn es geht ja um das grosse Ganze. Eindrücklich ist auch die Bühne, auf der wir agieren: Wir arbeiten im Auftrag aller Staatschefs der Welt, da hat man schon den Eindruck, dass man gehört wird. Was als «kleiner» Wissenschaftler nicht immer der Fall ist (lacht). Einmal nahm ich an einer Video-Sitzung des UN-Führungsgremiums unter der Leitung von Generalsekretär António Guterres teil. Da war ich vorher schon ein bisschen aufgeregt. Aber auch auf dieser Ebene wird wie in einer alltäglichen Sitzung um Lösungen gerungen. Am Schluss hielt der Generalsekretär ein sehr persönliches Plädoyer für die Nachhaltigkeit. Das war eindrücklich.
Im vergangenen September hat Ihr Gremium den ersten Bericht zuhanden der UN-Generalversammlung veröffentlicht. Was war für Sie dessen Kernbotschaft?
Wir wissen genug, um handeln zu können. Und aufgrund dieses Wissens müssen wir jetzt handeln und nicht erst an dem Punkt, an dem es zu spät ist – sei dies bei der Biodiversität, beim Klimawandel, bei wachsender Ungleichheit oder bei sozialen Spannungen.
Wie gelingt das?
Indem wir uns nicht auf das Erreichen einzelner Nachhaltigkeitsziele fokussieren, sondern Systemänderungen anstreben. Nehmen Sie die Ernährung, ein System, das weltweit komplett aus dem Gleichgewicht ist: Die Hälfte der Bevölkerung ist entweder unter- oder überernährt, die Nahrungsmittelproduktion ist gleichzeitig für einen grossen Teil des Biodiversitätsverlusts und für fast einen Drittel der Klimagase verantwortlich. Wenn man weltweit nun einfach mehr produziert, erzielt man vielleicht Fortschritte bei der Ernährungssicherheit, verliert aber bei der Biodiversität oder beim Klimawandel. Vier solcher grundlegender, systemischer Ansatzpunkte wurden definiert: Zur Ernährung kommen Produktion und Konsum sowie der Zugang zu erneuerbarer Energie, der vierte Systemansatz betrifft die Städte. Bis 2050 leben rund 70 Prozent aller Menschen in Städten. Wie Menschen sich dort ernähren oder Energie verbrauchen, wird die globale Nachhaltigkeit entscheidend beeinflussen. Wenn wir diese vier Systeme grundlegend verändern, könnten wir einen globalen Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung schaffen.
Können wir es tatsächlich schaffen? Allein schon die Tatsache, dass sich einzelne Ziele diametral widersprechen, schränkt die Erfolgschancen doch deutlich ein.
Wenn man die Ziele gegeneinander ausspielt, erweist man der Agenda einen Bärendienst. Sie sind trotz allem als Einheit zu verstehen. Klar: Die Widersprüche darf man nicht kleinreden. Aber wir haben festgestellt, dass es innerhalb der Nachhaltigkeitsziele mehr Synergien als Widersprüche gibt. Wenn wir zum Beispiel die Bildung der Frauen in Afrika fördern, hat das einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Kinder – was wiederum das Bildungsniveau erhöht. Es geht also darum, mit den vorhin beschriebenen Systemänderungen die Widersprüche zu überwinden. Das heisst: Wir müssen herausfinden, wie wir mehr Leute besser ernähren können, ohne damit Klima oder Biodiversität mehr zu schädigen. Wenn wir das schaffen, können wir die Ziele tatsächlich erreichen. Solange wir die einzelnen Ziele isoliert betrachten, wird uns das nicht gelingen.
Was braucht es für konkrete Veränderungen?
Unsere Gruppe unabhängiger Wissenschaftler hat vier mögliche «Lösungshebel» bestimmt. Dazu gehört der Unternehmens- und Finanzsektor und damit die Frage: Wo und wie soll die Wirtschaft wachsen? In Madagaskar, wo ich im August 2019 war, gibt es einen grossen und legitimen Anspruch auf Wirtschaftswachstum, während wir in der Schweiz wohl neue Formen des Wirtschaftens suchen müssen. Ein weiterer wichtiger Hebel ist individuelles Verhalten. Und auch die politischen Spielregeln sind entscheidend: Dass fossile Energieträger nach wie vor massiv subventioniert werden, statt dass die externen Umweltkosten auf den Preis geschlagen werden, ist eine absolute Katastrophe – eine Spielregel, die wir schleunigst ändern müssen. Hinzu kommt als vierter Hebel Wissenschaft und Technologie.
Welches ist der wichtigste Lösungsansatz?
Die Einsicht, dass es nicht einer alleine schaffen kann – nicht der Staat, nicht die Gesellschaft, nicht Wirtschaft oder Wissenschaft. Eine neue Art der Zusammenarbeit ist nötig. Es gibt keine technologische Innovation als Wunderheilmittel. Wir müssen viel eher die Technologie mit politischen Spielregeln verbinden, die Wissenschaft muss viel mehr mit den Regierungen oder dem Privatsektor zusammenarbeiten. Alle müssen raus aus ihren Ecken. Jedes Land muss dabei seinen eigenen Weg finden: Die Energiewende in der Schweiz zu schaffen, ist etwas komplett anderes, als sie in Madagaskar anzugehen. Die Prioritäten sind in jedem Land verschieden, entsprechend unterschiedlich müssen die Hebel kombiniert werden. Die Herausforderung, die Beziehung zwischen dem Menschen und der Umwelt in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen, ist hingegen überall die gleiche. Und da sind wir in der Schweiz nicht viel näher am Ziel, als es Madagaskar ist.
Weil wir einen möglichst ressourcenschonenden Lebensstil immer noch mit persönlichem Verlust gleichsetzen?
Viele tun das noch. Aber es findet in der Schweiz zunehmend eine öffentliche Wertediskussion statt, die auch von der Wissenschaft vorangetrieben werden kann: In welcher Welt wollen wir in Zukunft leben? Muss es wirklich ein Wochenende in Barcelona sein? Ist es nicht auch am Neuenburgersee sehr schön? Und immer mehr Menschen verbinden mit einem solchen Lebensstil längst nicht mehr nur Verlust und Verzicht, sondern vor allem auch Innovation, Kreativität und den Gewinn von neuen Freiheiten.
Bräuchte es also eher einen Weltpsychologen für die nötigen Verhaltensänderungen? Die wissenschaftliche Dringlichkeit ist ja längst bekannt.
Auch ein Weltpsychologe hält kein Universalmittel bereit und könnte es nicht im Alleingang richten. Wir sind alle Teil eines Systems, das sich ändern muss. Und solange CO2-Emissionen im Flugverkehr oder beim Heizen nicht den Preis haben, den sie haben müssten, hilft auch kein Weltpsychologe. Die Gesellschaft braucht als Ganzes neue Regeln, damit sich das Individuum auch ändern kann. Die nötigen Veränderungen bedingen ein Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktoren. Um beim Beispiel Reisen zu bleiben: Helfen könnte eine technologische Innovation, die den Zugverkehr schneller, besser und billiger macht. Beim Thema Essen müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass allein schon die Produktion von weissem Fleisch der Umwelt fast 10 Mal weniger schadet als jene von rotem Fleisch – bei der Produktion von Weizen und Reis ist der Schaden noch einmal um den gleichen Faktor kleiner.
Welche Note geben Sie der Schweiz in ihren Bemühungen zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele?
Im Durchschnitt eine 5, in vielen Punkten ist die Schweiz vorbildlich. Das Problem ist: Weil wir in anderen Punkten eine schlechte Figur abgeben, schmälert das die restlichen Bemühungen deutlich. Ungefähr drei Viertel der Schweizer Umweltbelastungen fallen im Ausland an, unser Wohlstand fordert einen viel zu hohen Preis. Hier versagen wir total. Tatsächlich wäre die Gesamtbeurteilung also ungenügend. Aber es gibt auch positive Entwicklungen: Gerade das BAFU unternimmt viel, um diese «versteckten» Umweltbelastungen im Ausland einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen. Nur die Politik hat noch nicht reagiert. Nicht nur in der Schweiz.
Was Sie pessimistisch stimmt?
Die globale politische Lage gibt tatsächlich nicht Anlass zu viel Optimismus! Und in der Bevölkerung ist die Agenda 2030 auch noch nicht wirklich angekommen. Aber bei den Unternehmen gibt es längst nicht nur schwarze Schafe, sondern sehr viele nachhaltige Innovationen. Der private Sektor und die Zivilgesellschaft machen mir Hoffnung. Und die brauchen wir auch. Denn es geht um das menschliche Überleben.
Weiterführende Informationen
Letzte Änderung 04.03.2020